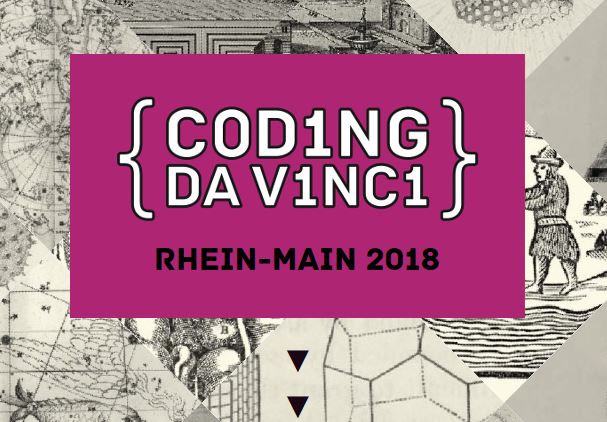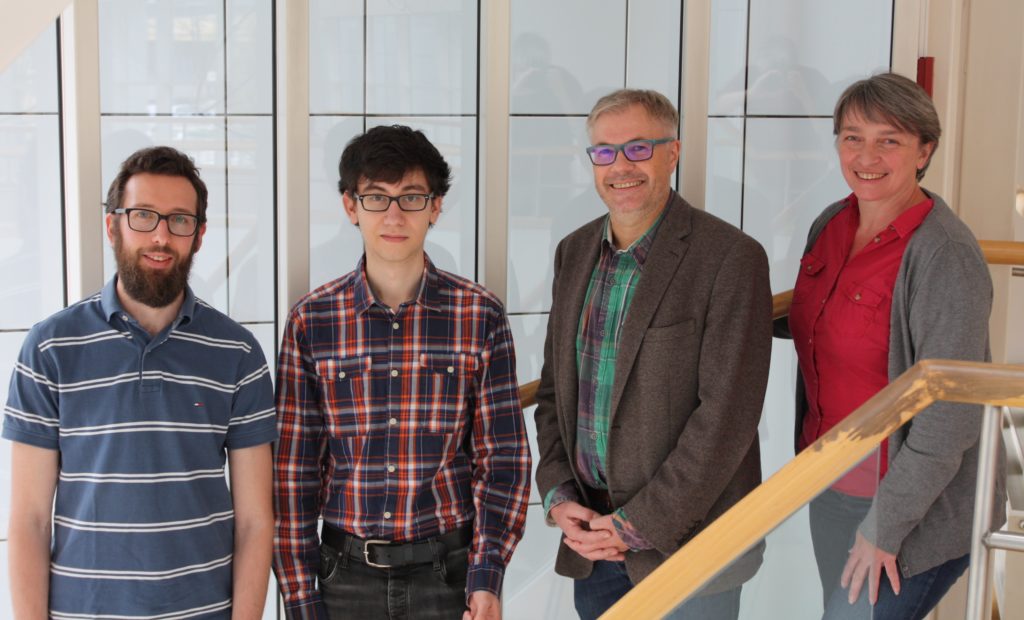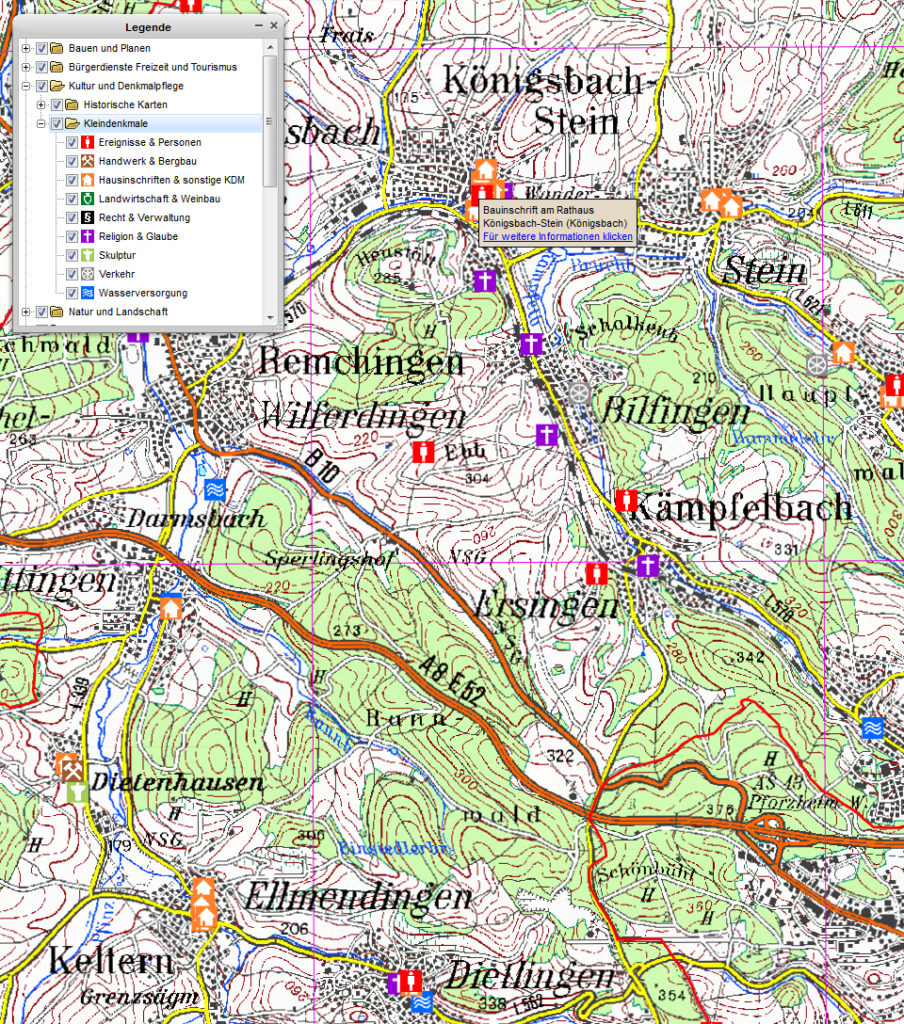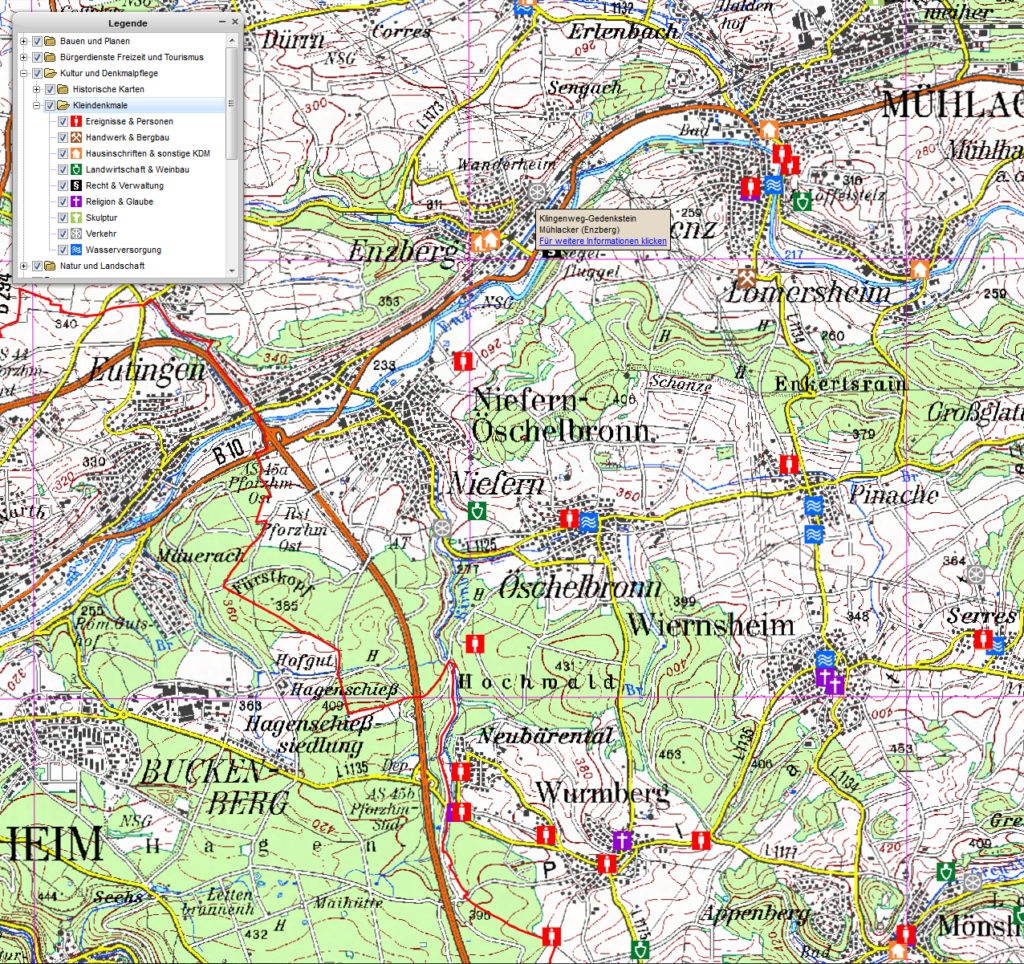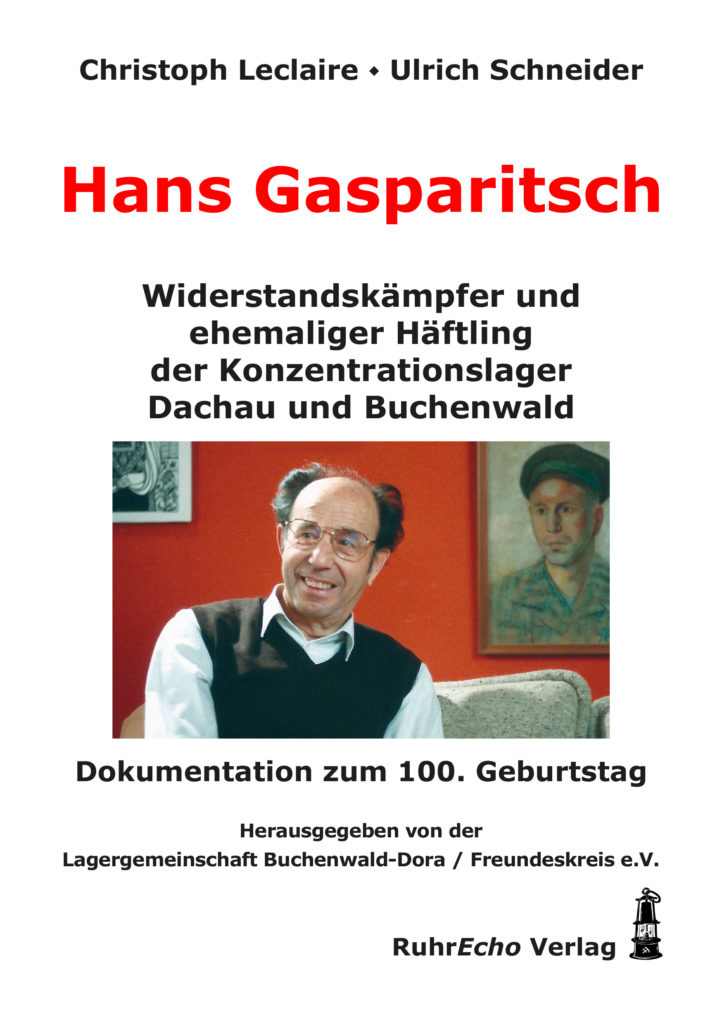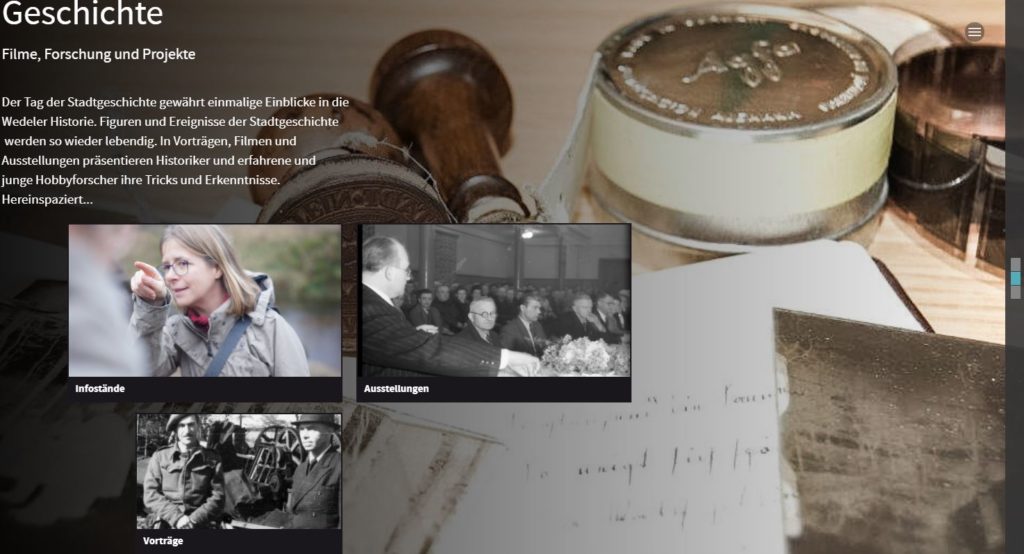Pfarrarchive – Quellen mit hohem Wert
Zum 3. Tag der Pfarrarchive hatte das Erzbistumsarchiv des Erzbistums Paderborn am 3.3.2018 nach Herford eingeladen. Neben einer spannenden Betrachtung zur Bedeutung der „Quellen aus Pfarrarchiven“ lud auch der Rundgang durch Herford mit einem Blick auf die spannende Kirchengeschichte der Stadt ein.
Schon seit einigen Jahren wird der bundesweite Tag der Archive vom Erzbistumsarchiv Paderborn als Gelegenheit benutzt, sich mit einer eigenen Veranstaltung an diejenigen zu wenden, die sich in den Kirchengemeinden des Erzbistums um die historischen Pfarrarchive kümmern. Rund 100 dieser ehrenamtlichen Archivpflegerinnen und Archivpfleger gibt es im Erzbistum. Sie kommen aus einem breiten beruflichen Spektrum. Neben Kaufleuten, Juristen, Verwaltungsfachleuten und Lehrern, die oft über ihre Arbeit im Kirchenvorstand zur Archivpflege gekommen sind, gibt es auch eine Reihe von Pfarrsekretärinnen, die sich für das Archiv ihrer Pfarrei stark machen. In einigen Pfarrarchiven sind mit Kommunalarchivaren und Historikern auch Profis am Werk.

Abb.: 35 von rund 100 Archivpflegern im Erzbistum Paderborn trafen sich am 3.3.2018 in Herford (Foto: Michael Streit)
Beim Treffen in Herford auf Einladung des Erzbistumsarchivs und die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist nach Herford konnte Erzbistumsarchivar Dr. Arnold Otto 35 Archivpfleger begrüßen. Die Kirchengeschichte dieser Stadt hatte schon Bistumsarchivar Dr. Alfred Cohausz (1936-1981) in seinen Publikationen leuchten lassen. Er war in Herford aufgewachsen und hatte über dessen mittelalterliche Rechtsgeschichte promoviert. Heute sorgt Pfarrarchivpflegerin Dagmar Kaufhold-Brackhane für die Überlieferung der Gemeinde. Sie ist Diplom-Bibliothekarin und dies war auch ihr Zugang zum Archiv. Ihr Schwiegervater hatte sie Mitte der 1980er Jahre gebeten, sich einmal um die historische Pfarrbibliothek zu kümmern, die jahrzehntelang unbeachtet auf dem Dachboden des Pfarrhauses in der ehemaligen Malteserkomturei Herford gelegen hatte.

Abb.: Pfarrarchivpflegerin Dagmar Kaufhold-Brackhane führte durch das Pfarrarchiv der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Herford (Foto: Michael Streit)
Bei der Sichtung stellte sie fest, dass es dort noch weit mehr Schätze zu heben gab. Seitdem sind mehr als 30 von liebevoller Detailarbeit erfüllte Jahre vergangen. Nun hatten die Archivpfleger aus dem gesamten Erzbistum die Gelegenheit, sich im Pfarrarchiv die Früchte dieser Arbeit anzusehen. Die Datenbank mit den Findmitteln des Herforder Pfarrarchivs wird vom dortigen Kommunalarchiv gespiegelt. Dort führte Stadtarchivar Christoph Laue vor, wie man mit seinen Rechercheanfragen im System fündig wird.
Mit einer Führung durch die historischen Kirchen von Herford machte Pfarrer. i.R. Udo Tielking die Herforder Kirchengeschichte greifbar: Ein historischer Kirchenraum nach dem anderen ließ von der Mission in Herford mit der Gründung des Damenstiftes, der Translation des Leibes der Heiligen Pusinna (860) und der nachfolgenden Gründung zahlreicher Orden und religiöser Gemeinschaften das kirchliche Leben in Herford bis in die Gegenwart lebendig werden. Die heutige Kirchengemeinde St. Johannes Baptist geht zurück auf einer Gründung des Malteserordens im Jahr 1220. Pfarrer Gerald Haringhaus, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn der Hl. Messe begrüßte, lebt noch heute im Gebäude der Malteserkomturei, dem ältesten Steinhaus das Herford aufweisen kann und in dem auch der historische Komtureisaal erhalten ist. Dort finden noch heute Sitzungen des Kirchenvorstandes statt.
Im modernen Pfarrsaal standen Erzbistumsarchivar Dr. Arnold Otto und Archivberater Michael Streit zur Aktuellen Stunde vielen Fragen offen, in der diesmal die Onlinestellung der Kirchenbücher und die Ergänzung des Rahmenaktenplans für pastorale Räume im Mittelpunkt standen.
Ein Höhepunkt des Tages war der Hauptvortrag von Prof. Dr. Werner Freitag vom Institut für Landesgeschichte und vergleichende Städtegeschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. Freitag, der auch zweiter Vorstand der historischen Kommission für Westfalen ist, hatte in der Vergangenheit nicht nur selbst immer wieder mit kirchengemeindlichem Archivgut geforscht, sondern auch seine Schüler für zahlreiche landesgeschichtliche Projekte über des Erzbistumsarchiv an die Pfarrarchive verwiesen. Sein Vortrag zu Quellen aus Pfarrarchiven und ihrem Wert für Orts- Landes- und Kirchengeschichte bot für die Arbeit in den Pfarrarchiven daher sehr direkte Anknüpfungspunkte. In einer lebhaften Diskussion wurden nicht nur diese, sondern auch Vernetzungsmöglichkeiten der Pfarrarchivpflege mit der Fachwissenschaft engagiert und Gewinn bringend diskutiert.
Der nächste Tag der Pfarrarchive wird am 7. März 2020 in Belecke stattfinden. Wer Interesse an einer Arbeit am Archiv der eigenen Kirchengemeinde hat, sollte zuvor mit dem Erzbistumsarchiv Paderborn Kontakt aufnehmen.
Kontakt:
Erzbistumsarchiv des Erzbistums Paderborn
Domplatz 3
33098 Paderborn
Telefon: +49 5251 125-1666 (Herr Streit)
Telefax: +49 5251 125-1470
archiv@erzbistum-paderborn.de
Quelle: Erzbistum Paderborn, Nachrichten, 5.3.2018