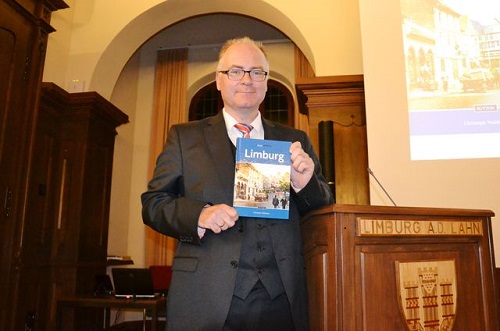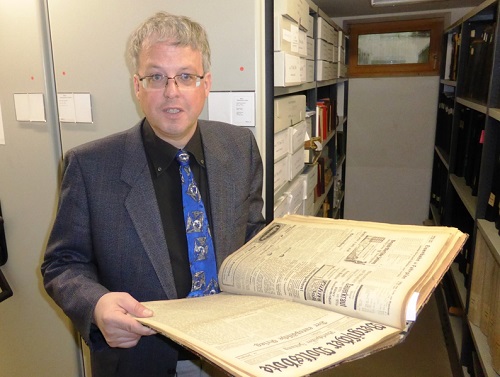Vom 24. Oktober 2013 bis zum 24. Februar 2014 zeigte das Landeskirchliche Archiv Kassel im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zum „Jahr der Konfirmation“ in seinen Räumlichkeiten die Ausstellung „Geschichten aus dem Konfirmationsmuseum“, Tafeln und Originale aus dem Konfirmationsmuseum in Neumünster. Die Exponate umfassten rund 200 Jahre. Dies war Anlass, den Bogen anschließend weiter zu spannen und den Versuch zu unternehmen, sich dem Fest, das in diesem Jahr auf eine 475 Jahre lange Tradition zurückblicken kann, in einer quellennahen Publikation umfassend zu nähern. Es finden sich Dokumente durch fünf Jahrhunderte zum Konfirmationsunterricht, zu Konfirmationsgottesdiensten, zu Konfirmationsscheinen und -fotos, zu Festessen und Geschenken. Dabei bleibt Kurhessen als „Mutterland“ der Konfirmation im Mittelpunkt der Betrachtungen, allerdings angereichert durch eine Umfrage in den Landeskirchlichen Archiven zu Einführung und Verbreitung der Konfirmation und eine EKD-Statistik zur Zahl der Konfirmierten in den letzten 40 Jahren. Archivalien aus der Pfalz und dem Rheinland sowie Exponate aus dem Konfirmationsmuseum Neumünster komplettieren die Darstellung.

Die Konfirmation ist zum einen Bestätigung der Taufe, verbunden mit dem ersten Abendmahl der dann mündigen Gemeindegliede, und zum anderen eine Familienfeier ersten Ranges, ein bürgerlich-weltliches Ereignis. Die Konfirmation ist ein öffentliches Fest, anders als Taufe oder Hochzeit, ein Ereignis, das bewusst in Gruppen vorbereitet und gefeiert wurde und wird. Daher spiegelt dieses Fest in besonderem Maße Sozialgeschichte.
Die Anfänge der Konfirmation finden sich in der „Ordenung der Christlichen Kirchenzuchte. Für die Kirchen im Fürstenthumb Hessen“, der so genannten „Ziegenhainer Zuchtordnung“ von 1539. Mit dem dritten Kapitel dieser vom Reformator Martin Bucer im Auftrag des hessischen Landgrafen Philipp I. verfassten Kirchenordnung wurde die Konfirmation als neues Fest eingeführt: „Dem allen nach sol dann der pfarher den selbigen Kindern / die hende aufflegen / und sie also im Namen des Herrn Confirmiren / unnd zu Christlicher gemeynschafft bestetigen / Auch darauff zum Tisch des Herrn gehen heyssen.“ Das „fürneme Fest“ mit dem ersten Abendmahl für die Konfirmierten wurde zu Ostern, Weihnachten oder Pfingsten begangen.
Hintergrund waren Auseinandersetzungen des Landgrafen Philipp mit den Wiedertäufern. In Zeiten der entstehenden evangelischen Landeskirchen wollten die Wiedertäufer die Erwachsenentaufe durchsetzen. Sie sollten eingebunden werden mit dem Angebot, nicht Erwachsene, sondern Kinder die Taufe selbst und aktiv bestätigen zu lassen. Martin Luther betrachtete die Konfirmation als entbehrlich, mit der Taufe sei alles Wesentliche gesagt. Wohl aber sollte der Getaufte wissen, was die Taufe für ihn bedeutet. Den Katechismus, den er 1529 geschrieben hatte, sollten die Getauften kennen. Dann seien sie reif, am Abendmahl teilzunehmen. Ein öffentliches Fest war nach Luther nicht notwendig. Als solches hat sich die Konfirmation jedoch durchgesetzt.
Am Anfang steht der Urtext der Kirchenzuchtordnung von 1539, am Ende u.a. eine im Jahr 2014 zur Konfirmation geschmückte Kirche sowie kollektive und individuelle Erinnerungen an das Fest.
Ein Kapitel widmet sich dem Konfirmationsunterricht durch fünf Jahrhunderte und setzt sich u.a. mit Texten zum „richtigen Alter“ der Konfirmanden auseinander. Orientiert an kanonischem Recht wurden Kinder mit den „Unterscheidungsjahren“, also dem Alter, in dem sie einer Religionsveränderung fähig erachtet (und auch strafmündig werden), konfirmiert. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts endete mit der Konfirmation in der Regel auch der Schulbesuch. Die Konfirmierten arbeiteten auf dem elterlichen Hof oder begannen eine Lehre. Die Eltern waren daran interessiert, ihre Kinder so früh wie möglich konfirmieren zu lassen. Da in Kurhessen seit 1692 vierzehn Jahre als Konfirmationsalter definiert war, wurden häufig Anträge auf Dispensation vom Konfirmationsalter gestellt.
Ein weiteres Kapitel stellt den durchorganisierten Konfirmationsgottesdienst in den Mittelpunkt. Es finden sich Quellen zum Zeitpunkt der Feier, zum Eintrag der Konfirmierten in die Kirchenbücher, zu Konfirmationsgebühren, dem Problem der Konfirmation „mixtae Religionis (aus vermischten Ehen)“, zum Kirchenschmuck, der angemessenen Kleidung, der „Rangirung der Confirmanden“ sowie Konfirmationspredigten. Bei den Verordnungen zu den „mixtae religionis“ wurde übrigens vorwiegend im 18. Jahrhundert geregelt, wie lutherische Kinder im reformierten Umfeld zu konfirmieren waren.
Konfirmationsandenken und -scheine, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts als offizielles Erinnerungsgeschenk der Kirchengemeinden durchsetzten, machen ein weiteres Kapitel aus. Vorläufer gab es mit Beginn des 19. Jahrhunderts, später dann Drucke mit jeweils zeittypischen Motiven.
Das Fest endete nicht mit Gottesdienst und Konfirmationsschein. Festessen und Geschenke, Andenken und – nicht zu vergessen – das Konfirmationsfoto gehörten seit Anfang des 20. Jahrhunderts dazu. Was bleibt, sind Erinnerungen der Heranwachsenden an ihren ersten großen Auftritt. Diese werden kollektiv betrachtet (Goldene Konfirmation) und individuell in Memoiren, Tagebuchauszügen und Gedichten.
Die vorliegende Publikation wurde komplett durch Drittmittel finanziert, die Druckkosten übernahm freundlicherweise das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der Verband kirchlicher Archive in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken (AABevK) unterstützte das Vorhaben.
Historische Quellen generieren einen Mehrwert. Wer sich darauf einlässt, erfährt Neues und erkennt Zusammenhänge. Das Landeskirchliche Archiv Kassel nimmt seinen Vermittlungsauftrag wahr, indem es Archivalien zur Geschichte dieses öffentlichen Festes präsentiert und den Betrachter so anregt, neue Erkenntnisse zu gewinnen und eigenen Erinnerungen nachzugehen.
Info:
Bettina Wischhöfer, „auff ein fürnemes Fest“ – Zur Geschichte der Konfirmation
(Schriften und Medien des Landeskirchlichen Archivs Kasel 35), Kassel 2014,
ISBN 978-3-939017-16-5,
110 Seiten, 12,90 €,
zu beziehen über Landeskirchliches Archiv Kassel oder den Buchhandel.
Kontakt:
Landeskirchliches Archiv Kassel
Lessingstraße 15 A
34119 Kassel
0561 / 788 76-0
archiv@ekkw.de
www.ekkw.de/archiv