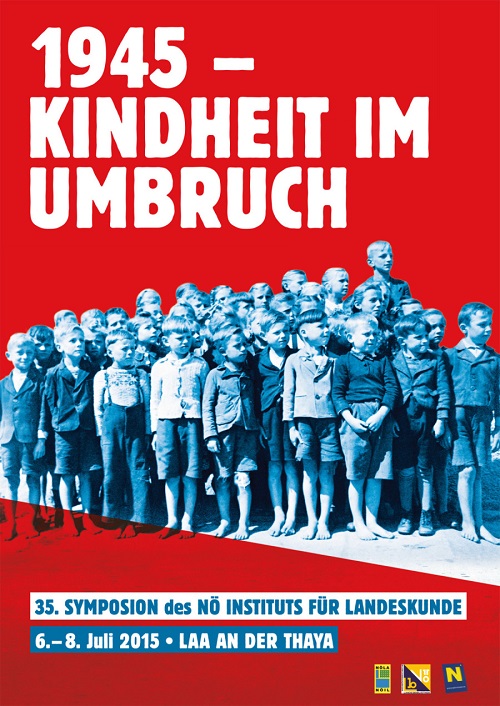Mit dem Archiv des Asso-Verlages Oberhausen hat das Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt ein Stück Literaturgeschichte des Ruhrgebiets in seine Bestände aufnehmen können. 12 große Umzugskisten mit Manuskripten und Korrespondenzen, Mappen mit Rezensionen, Verlagsanzeigen und -prospekten, Plakaten und Büchern fanden u.a. durch die Vermittlung des Schriftstellers Heinrich Peuckmann, selbst Autor des Verlags, den Weg nach Dortmund.
Der Verlag bot über ein Vierteljahrhundert regionalen Autoren die Möglichkeit sich im Zuge der politischen Bewegung nach 1968 mit engagierter Literatur zu Wort zu melden.
Die Berliner Publizistin Annemarie Stern und die aus Oberhausen stammende Anneliese Althoff gründeten gemeinsam 1970 den Asso-Verlag. Das programmatische Anliegen der Gründerinnen erklärt sich aus dem Zitat Alfred Döblins: Bücher sind Fahrpläne, die mitteilen können, wann man in den Städten namens Widerstand, Freiheit und Veränderung ankommt.
Als Lektorin legte Annemarie Stern die Schwerpunkte der Publikationen auf die Ruhrgebietsliteratur, die „Geschichte von unten“ und die literarische und künstlerische Darstellung des Arbeitslebens von Bergleuten, Stahlarbeitern und anderen Werktätigen. Die Abkürzung Asso, die sie von dem Wort Assoziation ableitete, bedeutete für sie die Zusammenarbeit von Menschen mit gemeinsamen Interessen.
Zu den wichtigsten Büchern der 95 Titel des Verlages gehören das Hochlarmarker Lesebuch: Kohle war nicht alles, 1981, eine Reihe von politischen Liederbüchern Anfang der 1970 Jahre und das in mehreren Auflagen erschienene Lesebuch Für eine andere Deutschstunde 1972.
2005 verkauften die Gründerinnen den Verlag an den ehemaligen Mülheimer Oberstadtdirektor und Vorstandsvorsitzenden der NRW.BANK, Ernst Gerlach. Die Leitung des Verlags übernahm Ingrid Gerlach. Unter dem neuen Label assoverlag erscheinen Belletristik und Sachbücher aus und über das Ruhrgebiet und das Land NRW.
Kontakt:
Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt
Grubenweg 5
44388 Dortmund
Telefon: 0231 50-23135
Fax: 0231 50-23229
fhi@stadtdo.de
fhi.dortmund.de