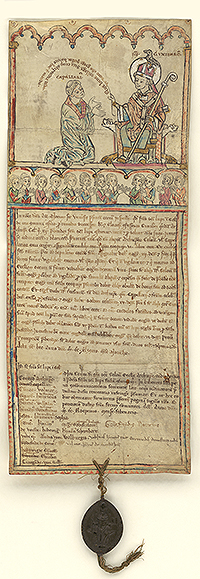Das Stadtmuseum Fürth zeigt vom 18. Oktober 2014 bis zum 12. April 2015 die Sonderausstellung „Fürth und der Erste Weltkrieg 1914-1918“. Die Ausstellung zeigt die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Kleeblattstadt und ihre Bewohner. Dies reicht vom (Über‑)Leben und Sterben der Fürther Soldaten an der Front bis hin zur Lage in der Heimat.
Zu sehen sind einmalige Objekte zur Fürther Geschichte. So sind zahlreiche Bilder, Dokumente und Objekte von der Heimatfront, wie beispielsweise Exponate aus den Metallsammlungen der Stadt, die bei deren Abgabe erhaltenen Gegenstücke im Sinne von „Gold gab ich für Eisen“ oder Christbaumkugeln in Bombenform ausgestellt. Zur Veranschaulichung der Ernährungssituation werden Ersatzstoffe und die zur Verfügung stehende Kalorienzahl für eine Person präsentiert. Ergänzt wird die Ausstellung durch Waffen und Ausrüstungsgegenstände Fürther Soldaten sowie durch eine Geruchsstation.
Der Eintritt in die Sonderausstellung beträgt 2,- Euro; 1,- Euro ermäßigt.
Begleitprogramm zur Ausstellung:
Sonntag, 26. Oktober 2014, 14 Uhr
Der Erste Weltkrieg hinter der Front – Fürth 1914 bis 1918, Vortrag von Prof. Dr. Georg Seiderer, Dozent der FAU Erlangen-Nürnberg
Sonntag, 18. Januar 2015, 14 Uhr
Fürths Frauen in der Zeit des Ersten Weltkriegs, Vortrag von Daniela Negwer, Gymnasiallehrerin Deutsch/Geschichte, freie Historikerin und Dozentin
Donnerstag, 5. Februar 2015, 19 Uhr
Alles wie bei uns – Feldpostbriefe und Lieder aus dem Ersten Weltkrieg, gelesen, gesungen und gespielt von Ulrike Bergmann. Einführung anhand der Rieß-Chronik von Dr. Alexander Mayer, Historiker
Sonntag, 15. Februar 2015, 14 Uhr
Sarajevo und die Folgen – Aktuelle Überlegungen zu Julikrise, Kriegsausbruch und Kriegsschuldfrage, Vortrag von Dr. Stefan Kestler, Historiker und Privatdozent
Donnerstag, 5. März 2015, 19 Uhr
Die Schrecken des Krieges 1914 bis 1918. Der Erste Weltkrieg in der Fotografie, Vortrag von Prof. Dr. Nils Büttner, Dozent der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Sonntag, 15. März 2015, 14 Uhr
Des einen Freud, des anderen Leid? Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns und Frankens, Vortrag von Prof. Dr. Dirk Götschmann, Dozent i. R. der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Donnerstag, 2. April 2015, 19 Uhr
Mit Gott fürs Vaterland – Die (Fürther) Kirchen und der Erste Weltkrieg, Vortrag von Alexander Jungkunz, stellvertretender Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, und Norbert Küber, stellvertretender Leiter des Studios Franken, Bayerischer Rundfunk
Als Begleitband zu den Ausstellungen im Großraum erschien das Buch „Der Sprung ins Dunkle – Die Region Nürnberg im Ersten Weltkrieg, 1914-1918“, 1050 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. Der Titel ist im Museum oder im Buchhandel zum Preis von 38 Euro erhältlich.
Kontakt:
Stadtmuseum Fürth Ludwig Erhard
Ottostraße 2
90762 Fürth
Tel.: 0911/97922290
Fax: 0911/97922299
info@stadtmuseum-fuerth.de
www.stadtmuseum-fuerth.de