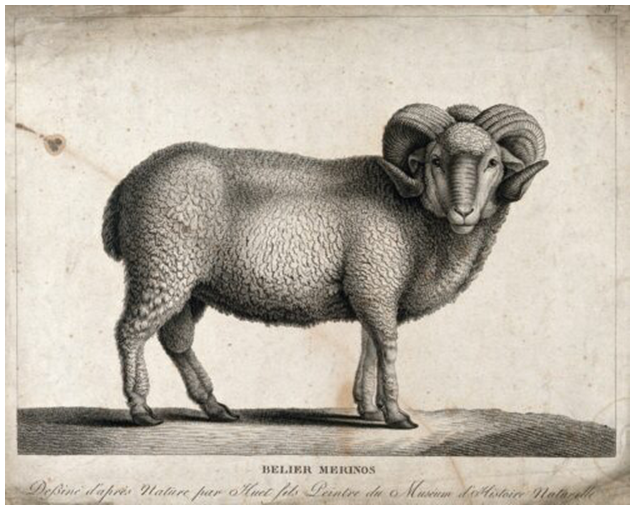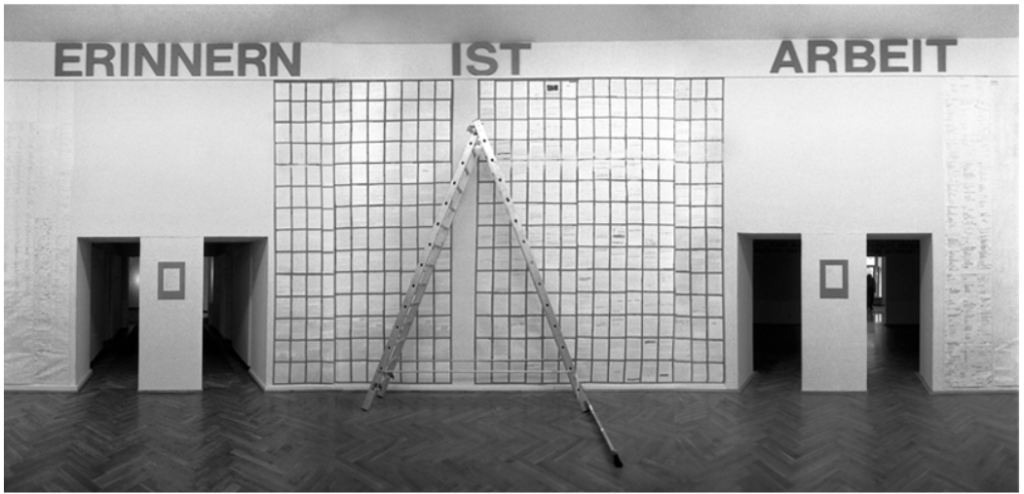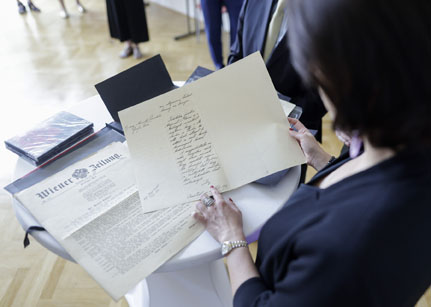Ein schweres Unwetter hatte Ende Mai 2016 große Schäden in vielen Kommunen im Kreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis verursacht. Besonders betroffen waren damals die Städte Künzelsau, Forchtenberg und Niedernhall. Mittlerweile ist dort nicht nur der Hochwasserschutz verbessert worden. Das Stadtarchiv Niedernhall (Hohenlohekreis) ist nunmehr auch wieder benutzbar.

Abb.: Aufräumarbeiten in der Innenstadt Niedernhalls Ende Mai 2016 (Foto: Stadt Niedernhall).
Am 29.5.2016 hatte außergewöhnlicher Starkregen zum Anschwellen des durch Niedernhall fließenden und in den Kocher einmündenden Forellenbachs und zur Überflutung weiter Teile der Innenstadt geführt. Das in den Kellerräumen des Rathauses untergebrachte Stadtarchiv Niedernhall lief infolgedessen bis zur Decke mit Wasser und Schlamm voll. Mit der Bergung der Archivalienhatte einen Tag später begonnen werden können. Rathausmitarbeiter und Helfer befreiten das Archivgut auf dem Platz vor dem Rathaus vom gröbsten Schmutz, bevor es der Gefriertrocknung zugeführt wurde. Durch die rasche Erstversorgung konnten knapp 99 Prozent des Archivgutes gerettet werden.
Zwischen August 2019 und 2020 wurde das in 329 Kartons aufbewahrte Archivgut neu geordnet und verzeichnet. Das neue Findbuch ist über die Webseite des Landesarchivs Baden-Württemberg online recherchierbar. Bis auf einige geschädigte Materialien, die sich noch einer professionellen Restaurierung unterzogen werden, ist der Großteil der Archivalien bereits wieder im Rathaus Niedernhall einsehbar. Der Bestand „Niedernhall I (Nie 1)“ hat nun einen Gesamtumfang von 148 lfd. Meter. Einige der 36 Urkunden, 2.137 Akten, 474 Bände und 5 Karten fehlen aufgrund des Hochwassers sowie durch vorherige Entnahmen. Die Laufzeit des Bestandes umfasst den Zeitraum von 1488 bis 2000. Bereits 1996 war vom damaligen Kreisarchivar Rainer Gross der nunmehr als „Niedernhall II“ bezeichnete Bestand gebildet worden.
 Abb.: Innenstadt Niedernhall (Foto: Stadt Niedernhall)
Abb.: Innenstadt Niedernhall (Foto: Stadt Niedernhall)
Seit 2016 wird in Niedernhall auch kräftig in den Hochwasserschutz investiert. Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes erneuert der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Stadt Niedernhall die Hochwasserschutzeinrichtungen am Kocherufer, um das gesamte Stadtgebiet künftig vor einem hundertjährlichen Hochwasser einschließlich der zu erwartenden größeren Hochwasserstände durch Klimaveränderungen zu schützen. Aktuell im Bau befindlich ist ein großes Hochwasserrückhaltebecken. Dessen Kosten belaufen sich auf 6 bis 7 Millionen Euro, wovon das Land Baden-Württemberg 70 Prozent bezuschusst. Im September 2021 soll das Becken fertiggestellt sein. Weitere Maßnahmen sind in Niedernhall derzeit nicht geplant. – Niedernhalls historischer Stadtkern steht seit 1983 als Gesamtanlage unter Denkmalschutz. Im Rathaus in der Hauptstraße 30 ist neben dem Stadtarchiv auch das Heimatmuseum untergebracht.
Fachlich berät und unterstützt das Kreisarchiv des Hohenlohekreises die Stadt Niedernhall wie auch weitere Städte und Gemeinden des Landkreises, deren Archive nicht hauptamtlich verwaltet werden.
Kontakt:
Kreisarchiv Hohenlohekreis
Schlossstraße 42
74632 Neuenstein
Tel.: 07942 941264
Fax: 07942 941265
kreisarchiv@hohenlohekreis.de
Quelle: Fränkische Nachrichten, 21.7.2021; SWR aktuell, 29.5.2021; SWR aktuell, 21.7.2021; Regierungspräsidium Stuttgart, Baden-Württemberg, Pressemitteilung, 29.9.2020; Dr. Thomas Kreutzer (Kreisarchiv Hohenlohekreis): Findbuch-Einleitung Bestand Niedernhall I, Juni 2021; Heilbronner Stimme, 14.9.2021.