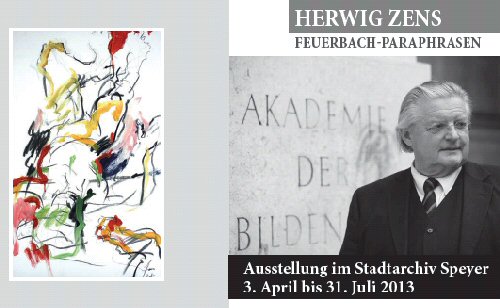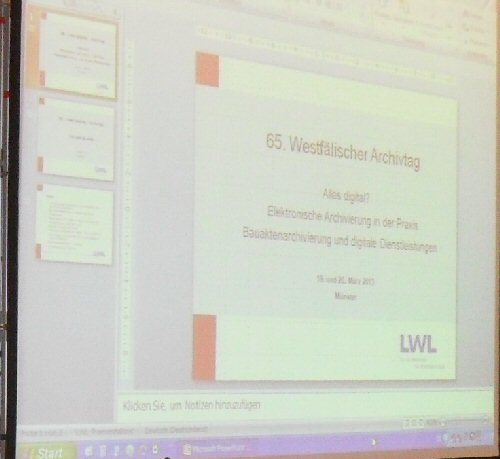Im historischen Rathaus der Stadt Münster fand am 19. und 20 März 2013 der 65. Westfälische Archivtag statt. Das übergreifende Thema der mit 250 Besuchern restlos ausgebuchten Veranstaltung lautete dieses Jahr "Alles digital? Elektronische Archivierung in der Praxis, Bauaktenarchivierung und digitale Dienstleistungen." Die Wahl war auf Münster gefallen, um das 100-jährige Jubiläum der hauptamtlichen Führung des Stadtarchivs Münster zu begehen.
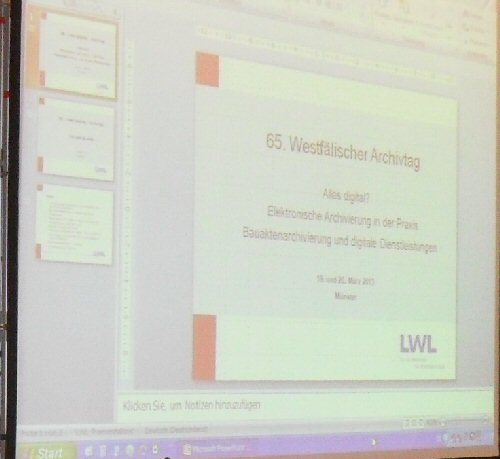
Die Eröffnung des Archivtags oblag Michael Pavlicic, dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, der das elektronische Langzeitarchiv des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) als Masterlösung für Mitgliedsarchive bewarb und auf die Vorteile von Einheitlichkeit und Synergien bei gemeinsamer Umsetzung der Herausforderung Digitalisierung verwies. Es folgten Grußworte von Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, sowie des Herzogs von Croy, Vorsitzender der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. und von Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, scheidender Präsident des Landesarchivs NRW.
Die Einführung in das Thema der Tagung übernahm Dr. Marcus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes für Westfalen, und warnte in dieser vor dem Schreckgespenst des "digital cliff", was den befürchteten, plötzlichen Totalverlust von digitalisierten Daten bedeutet, der im Gegensatz zu dem schleichenden Verfall von herkömmlichen Archivalien steht. Er betonte außerdem die Wichtigkeit von praktischen Erfahrungen und den Zusammenschluss zu Nutzergemeinschaften, da die Digitalisierung, welche er als Herausforderung begreift, die von auf sich allein gestellten Archiven nicht bewältigt werden könne. Mit Blick auf den inhaltlichen Schwerpunkt des zweiten Tages der Veranstaltung verwies er außerdem auf die zentrale Rolle von Bauakten für die Erschließung der Stadtgeschichte.
Den Eröffnungsvortrag, welcher sich mit der wechselhaften, 60-jährigen Geschichte des LWL beschäftigte, hielt Prof. Dr. Bernd Walter vom LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte. Er beleuchtete die verschiedenen Aufgaben des Landschaftsverbandes, welche weit über die in der Öffentlichkeit am ehesten wahrgenommene Kulturförderung hinausgehen und beispielsweise Behindertenhilfe, Psychiatrie und Jugendarbeit umfassen. Dabei betonte er die Veränderungen, die viele dieser Bereiche in ihrer Geschichte erfahren haben und betonte auch die dunklen Seiten der Geschichte, beispielsweise den körperlichen und seelischen Missbrauch von Kindern in Jugendheimen in den vergangenen Jahrzehnten. Auch über die Einbindung in die Politik und die rechtliche Stellung des LWL klärte er auf.
Näheren Archivbezug enthielten die folgenden Vorträge, welche sich mit der Langzeitsicherung von elektronischen Unterlagen befassten. Auf eine kurze Einführung durch Moderatorin Anja Gussek vom Stadtarchiv Münster, welche die zentrale, wenn auch nicht allumfassende Rolle digitaler Daten und die Wichtigkeit von Kooperationen verschiedener Institutionen zur Entwicklung langfristiger Archivierungsstrategien für diese betonte, erfolgte ein Erfahrungsbericht von Eckhard Möller (Stadtarchiv Harsewinkel) und Heiner Jostkleigrewe (regio iT, Gütersloh), die in enger Kooperation das Programm Archivo entwickelt hatten, welches die Übernahme von digitalen Daten des Einwohnermeldeamts für Archive ermöglichen soll. Dabei wurde kurz die Geschichte der Meldedaten beleuchtet, welche sich von Familienkarten ab ca. 1950 zu personenbezogenen Meldedaten gewandelt haben. Es wurde vor allem die Dringlichkeit einer Lösung für den "digitalen Gedächtnisverlust" betont. Zwar werden die Datensätze grundsätzlich Jahrzehnte nach Tod oder Wegzug erhalten, jedoch trifft dies nicht auf alle Bestandteile des Datensatzes zu. So werden beispielsweise Steuerkarten und Religionszugehörigkeit ein Jahr nach Tod oder Wegzug der betroffenen Person gelöscht, die Familienverkettung wird sogar bereits mit Erreichen des 18. Lebensjahrs gelöscht, für spätere Familienforscher sind diese Daten aber von unschätzbarem Wert.
Als eine Art Musterlösung für das Problem wurde die Software Archivo vorgestellt, welche die Übernahme von zur Löschung vorgesehen Datensätzen durch die Archive im XML-Format ermögliche und außerdem das Recherchieren, Zusammenfügen und Drucken der entsprechenden Informationen ermögliche. Die Nutzung erfolge im Einklang mit dem Archivgesetz und eigne sich für die Zusammenarbeit verschiedener Archive und Partner. In der folgenden Diskussion wurde das Problem festgestellt, dass nicht alle Meldeämter mit Archivo kompatible Datensätze nutzen und außerdem die für kleine Archive mitunter nicht zu stemmenden Lizenzgebühren angemahnt.
Ein weiteres Beispiel aus der Praxis erläuterte der folgende Beitrag von Dr. Peter Worm und Katharina Tiemann vom LWL-Archivamt für Westfalen. Dabei wurden die durch die Heterogenität der Aufgabenfelder des Verbandes bedingten organisatorischen Schwierigkeiten erläutert und als Lösung das Programm Doxis 4 der Firma SER vorgestellt, welches nicht nur Vorgangsbearbeitung von elektronischen Akten ermögliche, sondern als komplettes Redaktionssystem für diese dienen könne. Ein Problem stelle die permanente Aktualisierung der Daten dar, die vom Programm so nicht erfasst werden könne, da bei einer Überarbeitung einer Datei automatisch die vorherige Version überschrieben würde. Als Lösung dafür diene die Nutzung von Zeitschnitten bei der Archivierung der Daten, sodass der Arbeitsprozess an diesen jeweils sichtbar werde. Als Fazit wurde festgehalten, dass gute Kommunikation und Organisation elementar für die Umsetzung von E-Akten seien, auf Rechtssicherheit zu achten sei und außerdem eine ganzheitliche Betrachtung des Problems erfolgen müsse, welche den gesamten Lebensweg der e-Akte von Erstellung bis zur Archivierung im Blick habe. Auch hier wurde erneut die zentrale Rolle von Kooperation verschiedener Partner betont.
Auch der dritte Vortrag zu dem Oberthema Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen schlug in eine ähnliche Kerbe. Im gemeinsamen Vortrag von Prof. Dr. Andreas Engel (Geschäftsführer des Verbands kommunaler Archivdienstleister KDN, Köln), Thorsten Preuss (Amt für Informationsverarbeitung, Köln) und Manfred Huppertz (Historisches Archiv der Stadt Köln) wurde die Benutzung eines Schwestersystems des LWL-Systems bei der Stadt Köln erläutert, welche aus der HP/SER Benutzergruppe stamme, welcher u.a. das Bundesarchiv, das Landesarchiv NRW sowie das Archiv des LWL angehören. Die Rolle des KDN sei dabei die eines Vermittlers, der zwischen Nutzern und Anbietern von Archivsoftware Kontakt herstelle und so für Synergieeffekte bei der gemeinsamen Entwicklung der entsprechenden System Sorge. Als Fazit der praktischen Erfahrung bei der Elektronischen Langzeitarchivierung kam man auf die simple Formel "Besser im Verbund."
Mitunter kontroverse Debatten fanden im nachmittäglichen Diskussionsforum zu Innovationen bei der Erinnerungsarbeit von Archiven statt, welches von Christoph Laue (Kommunalarchiv Herford) moderiert wurde. Grundlegende Einigkeit bestand darin, dass das Archiv bei der Erinnerungsarbeit primär Dienstleister für Vereine, Initiativen und Politik sei. Wie die Verbindung aber aussah, wurde durchaus unterschiedlich gesehen. Während manche von einem Geben und Nehmen sprachen und erfolgreiche Kooperation lobten, beklagten andere die Deutungshoheit von Politik gegenüber Archiven und Historikern und fühlten sich mit der Erinnerungsarbeit oft von Vertretern aus Politik allein gelassen. Dabei berichteten einige Teilnehmer über die Erfahrung, dass häufig Arbeit auf die Archive "abgewälzt" würde, welche nicht ihrem Aufgabenbereich und ihren Ressourcen entspreche. Außerdem befürchtete man, sich bei eigener Initiative zur Erinnerungsarbeit durch die daraus häufig entstehenden Kontroversen politisch positionieren zu müssen. Andere sahen die Kontroverse durchaus als Chance für die Erinnerungsarbeit und das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung an. Es wurde ebenfalls in Frage gestellt, was überhaupt heutzutage noch innovativ sei, als eines der wenigen wirklich neuen Beispiele in der Erinnerungsarbeit wurden QR-Codes bei Denkmälern genannt, die bisher weniger geschichtsinteressierten Jugendlichen einen Zugang zur Erinnerungsarbeit verschaffen könnten.
Den inhaltlichen Abschluss des Abends bildete ein Vortrag von Dr. Hannes Lambacher (Stadtarchiv Münster), welcher über die 100 Jahre hauptamtliche Führung des Stadtarchivs referierte und dabei die Geschichte von Stadt und Stadtarchiv zu verknüpfen wusste. Eine Kontinuität dieser Geschichte war der Ruf von Münster als "schwarze" Stadt, durchdrungen von einem abgeschlossenen, konservativen, katholischen, vormodernem und autoritären Verständnis Milieu. Diese Vorstellung habe sich von den Zeiten des Kulturkampfes bis in die 1980er Jahre erhalten und sei erst durch Modernisierung und erfolgreiches Stadtmarketing durchbrochen worden.
Endgültig beschlossen wurde der erste Tag mit einem Empfang der Stadt Münster mit anschließendem Abendessen im Stadthaus.
Am zweiten Tag der Veranstaltung stand die Überlieferung von Bauakten im Vordergrund. Den Anfang machte Dr. Michael Huyer (LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Münster) mit einem Vortrag über den historischen Wert von Bauakten für die Stadtgeschichte. Dabei betonte, dass die Bauakten nicht nur einen individuellen Zeugniswerten hätten, sondern auch für übergreifende Fragestellungen relevant seien. Ein Beispiel dafür sei die Verwendung des Baumaterials, welches Schlüsse zur Wirtschaftsgeschichte ermögliche, außerdem wiesen die Situationspläne über das eigentliche Gebäude hinaus. Außerdem stellten Bauakten oft die einzige kontinuierliche Dokumentation von weniger exponierten Gebäuden dar. Daher plädierte er für die Erhaltung aller Bauakten und sprach sich gegen die Vernichtung von Bauakten nach der Digitalisierung aus, was auf Widerspruch einiger Archivare stieß.
Unter dem Titel "Scan und gut? Bauaufsichtsakten im digitalen Zeitalter als Herausforderung für Archive" befasste sich Dr. Axel Metz vom Stadtarchiv Bocholt mit den Auswirkungen der Digitalisierung von Bauakten auf deren Archivierung. Dabei warf er die Frage auf, ob übergeordnete Rechtsnormen Scan und anschließende Vernichtung der Akte überhaupt zulasse. Er sprach sich nicht grundlegend gegen dieses Verfahren aus, betonte jedoch, dass dafür einige Voraussetzungen gegeben seien müssen, beispielsweise eine ausreichende Qualitätssicherung des Scans, eine Einzelfallüberprüfung des intrinsischen Wertes der jeweiligen Akte und die bestehende Möglichkeit für elektronische Langzeitarchivierung. Da diese Voraussetzungen oftmals noch nicht erfüllt würden, sei eine Vernichtung der Akten zur Zeit noch sehr kritisch zu betrachten so das Fazit der folgenden Diskussion. Er widersprach außerdem seinem Vorredner, indem er nicht alle Baupläne als archivwürdig bezeichnete. Zum Abschluss betonte er bei der Digitalisierung auch die Bringschuld der Archive, welche darin bestände, dass Grundlagen für die Bewertung der Archivwürdigkeit von Bauakten geschaffen werden müssten.
Mit der praktischen Umsetzung dieser Grundlagen befasste sich der folgende Vortrag von Annett Schreiber vom Institut für Stadtgeschichte in Gelsenkirchen. Sie beschrieb die Praxiserfahrungen, die das Institut bei einem Pilotprojekt zur Bewertung der Archivwürdigkeit von Bauakten gemacht habe. Dabei sei angesichts der Zerstörungen im 2. Weltkrieg jede Akte mit einem Baubeginn vor 1945 grundsätzlich als archivwürdig einzustufen. Außerdem archivwürdig seien öffentlichkeitswirksame Gebäude, wie Geschäfts- und Fußgängerzonen, Sehenswürdigkeiten, Gebäude, welche mit Architektenpreisen ausgezeichnet wurden sowie alle Gebäude, die ihren Niederschlag in der Presse fanden. Bei den Wohnbeständen sei ein Architekt zu Rate zu ziehen, um Baustile und ähnliches zu bewerten. Außerdem sei es wichtig, die Heterogenität der Stadt Gelsenkirchen zu betonen, daher hätte man stets darauf geachtet, exemplarische Bauakten für die unterschiedlichen Entwicklungen der späteren Stadtteile zu erhalten. Kassiert hingegen wurden Akten ohne Pläne, Abbruchakten, Akten von Stallgebäuden, Schuppen, Lagerhallen, (Wohn)barracken (außer bei Verbindung zu Asylanten oder Zwangsarbeitern), nicht realisierte Pläne, Akten zu Schornsteinen, Heizungen, fliegenden Bauten, Umkleiden, Gewächshäusern, Wartehäuschen, fliegende Bauten, Behelfsheime, Gartenlauben, Trinkhallen, Toilettenanlagen, Parkhäusern, Spielhallen und Werbeanlagen. Außerdem wurde betont, dass viele der Bereiche aufgrund der industriellen Vergangenheit auch in den Zuständigkeitsbereich des Umweltamtes fielen und daher eine entsprechende Kooperation nötig sei. Zu achten sei bei der Auswahl auf Besonderheiten in der Stadtentwicklung und in den Akten, verschiedene Wohntraditionen, Benutzerwünsche und die Bestandsdauer der Gebäude, ein Blick auf andere ähnliche Akten sowie die Auswahl an archivwürdigen Vorgängen in den Akten. Anschließend wurde der Verkauf von bereits eingescannten Bauakten an die Eigentümer des Gebäudes diskutiert, welches von einigen Kommunen bereits praktiziert wird. Hier äußerte man rechtliche Bedenken, da durch den Einsatz eines Vermittlers möglicherweise Dritte Zugang zu sensiblen, persönlichen Daten erhalten würden.
Einen Einblick in die aktuelle Verwaltungsarbeit mit Bauakten gewährte der folgende Beitrag von Michael Möllers und Thomas Overkott vom Stadtplanung- und Bauordnungsamt in Bochum. Sie beschrieben, wie elektronische Akten die Lösung für die oft langwierige und schwerfällige Zirkulation von Bauakten gewesen sei, über die sich Unternehmen oft beschwert hätten. Diese Langsamkeit entstand v.a. dadurch, dass oft bis zu 12 verschiedene Behörden nacheinander die Dokumente prüfen mussten. Durch digitale Akten könne dies nun gleichzeitig geschehen. Dabei sei die digitale Akte aber als Zusatz, nicht als Ersatz der Papierakte zu sehen. Außerdem erfolge keine nachträgliche Digitalisierung mit anderen Behörden. Hauptmotivation für die Einführung der digitalen Akten sei allein die Zeitersparnis im Kontakt mit anderen Behörden gewesen. Im Umgang mit den Archiven seien bei digitalen Akten zur Zeit noch einige Fragen ungeklärt, beispielsweise ist unklar, ob eine Signatur oder ein Zeitstempel benötigt wird, in welchem Format die Daten vorliegen sollen und ob die Papierakte vernichtet werden dürfe.
Den finalen Vortrag hielt Hans-Jürgen Höötmann vom LWL-Archivamt für Westfalen in Vertretung von Nicola Bruns. Die Arbeit von Bruns beschrieb die Arbeit mit digitalen Gebäude- und Geländeplänen, welche in einer Oracle-Datenbank zentral gespeichert werde. Dieses System habe einen dynamischen Aufbau, besitze aber keine Historie, d.h. Änderung überschreiben automatisch die jeweils vorherige Version. Das System sei grundsätzlich als archivwürdig einzustufen und nutze ausschließlich digitale Daten. Dabei seien aber nicht alle Liegenschafts- und Gebäudedaten archivwürdig und es müsse eine Einzelbewertung erfolgen. Außerdem sei zu klären, welche Zeitschnitte für die Archivierung gewählt würden. Eine Alternative sei die Informationen in Form einer PDF-Datei auslesbar zu machen, was die Daten leichter nachvollziehbar mache, dabei aber die Datenbankstruktur des Systems aufgebe. Nach ausgiebiger Diskussion habe man sich für diesen Weg entschlossen, um die Daten besser zugänglich zu machen. Das Fazit dieser Erfahrung bestehe darin, dass neue Quellen jeweils auch neue Ansätzen bei der Überlieferungsbildung erfordern.
Abgeschlossen wurde der Archivtag mit der Aktuellen Stunde, in dem verschiedene anstehende Anlässe und Fristen behandelt wurden. Beworben wurde der 66. Archivtag, welcher im folgenden Jahr in Bielefeld stattfinden wird. Außerdem wurden verschiedene Fristen von Projekten mit finanzieller Förderung von Digitalisierung genannt. Des Weiteren wurde auf eine anstehende Lehrerfortbildung hingewiesen, welche auf die Kooperation mit Archiven angewiesen sei. Weiterhin wurde auf eine Gesetzesänderung verwiesen, die die Übernahme von beim Landesarchiv kassiertem Archivgut durch die Kommunalarchive ermögliche, was bisher aber kaum genutzt worden sei.
Nach den Vorträgen bestand für Besucher noch die Möglichkeit zur Besichtigung von Stadtarchiv und Technischem Zentrum des Landesarchivs.
Insgesamt stand der Archivtag gewissermaßen unter dem ungenannten Motto "Einigkeit macht stark." Die durch die Digitalisierung anfallenden Herausforderungen waren in vielen Fällen nur im Verbund und in Kooperation mit entsprechenden Dienstleistern zu realisieren. Dies schonte nicht nur die Ressourcen kleinerer Archive, sondern konnte auch für Einheitlichkeit und Synchronisierungseffekte sorgen. Grundsätzlich wurde bei der Realisierung des Umgangs mit digitalen Akten noch ein großer Arbeitsbedarf ausgemacht, viele Lösungen befinden sich noch in der Testphase. Die neuen Quellenarten erfordern auch neue Grundlagen bei der Bewertung der Archivwürdigkeit, der Übernahme und dem Verzeichnen. Dabei drängt häufig die Zeit, da bereits einige digitale Daten durch Löschung unwiederbringlich verloren sind.
Abstracts der Vortrage und weitere Eindrücke von der Tagung können im Blog des Archivtags eingesehen werden:
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Archivamt/westfaelischer-archivtag-blog/
Raphael Hennecke (Bielefeld)