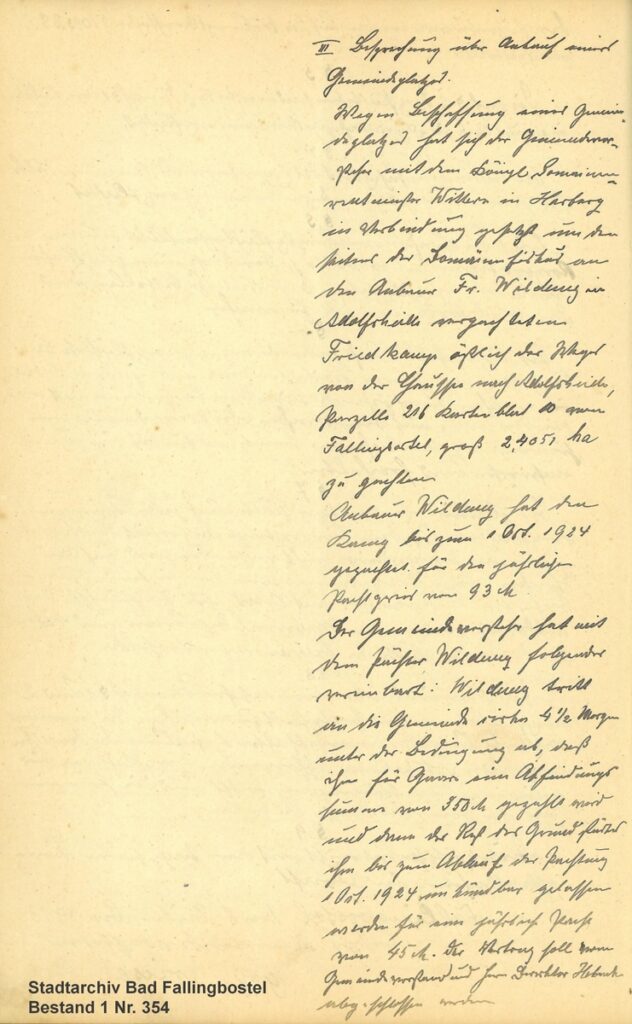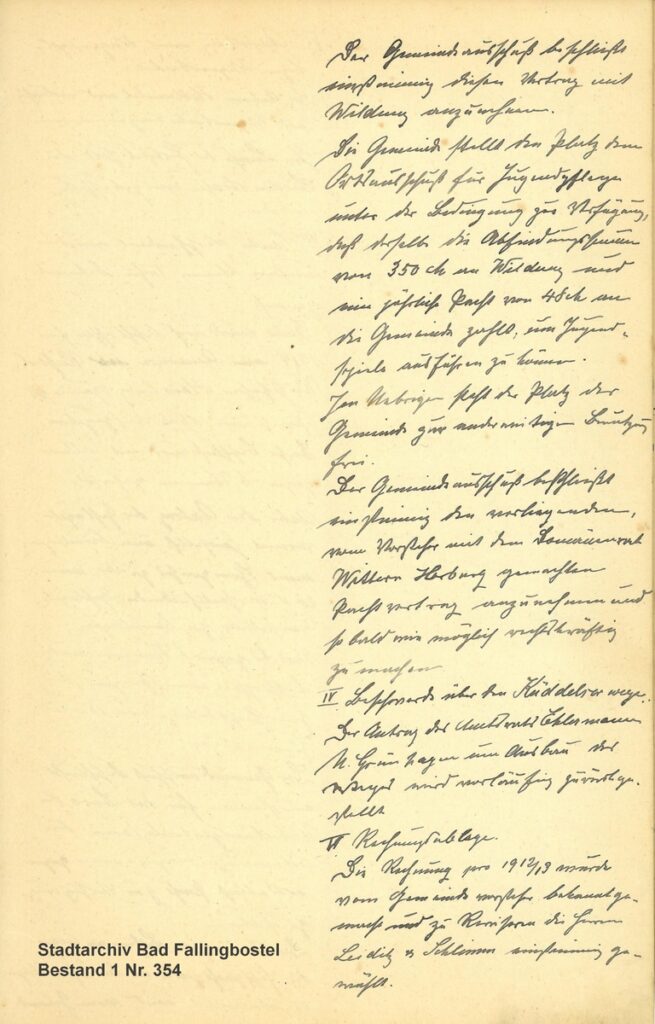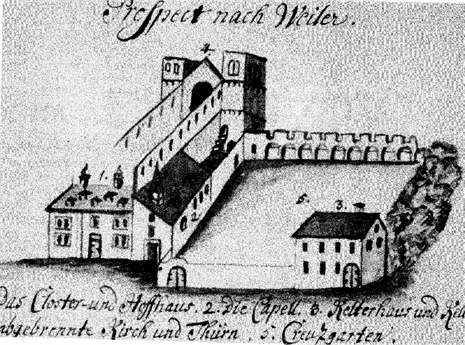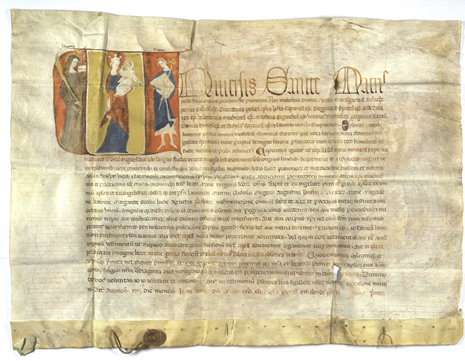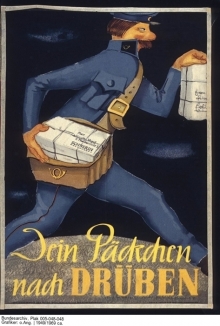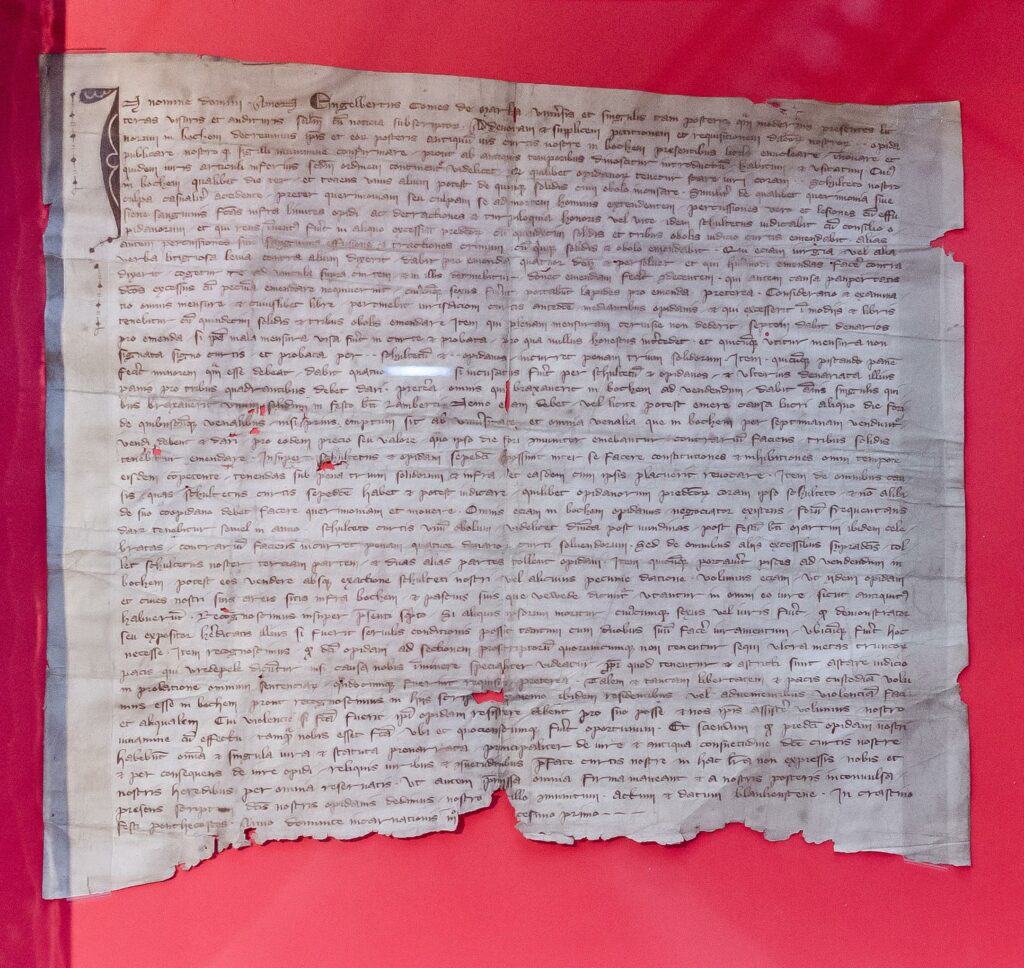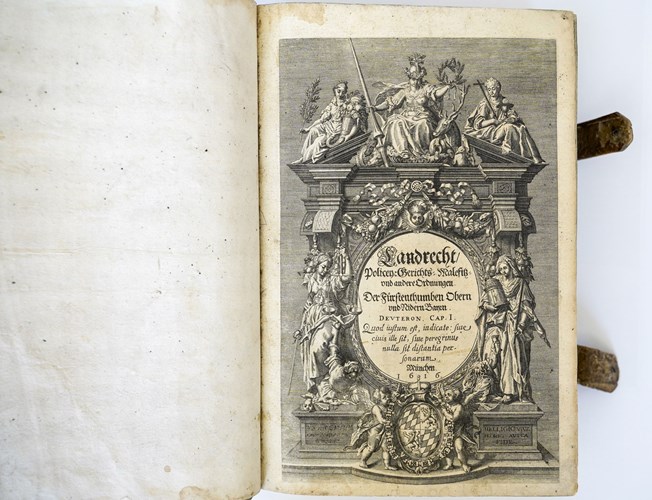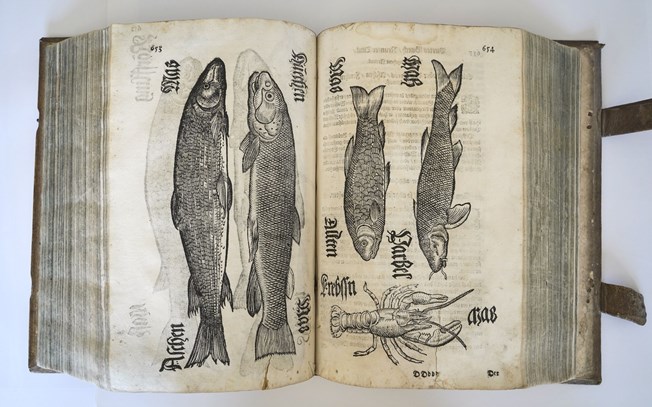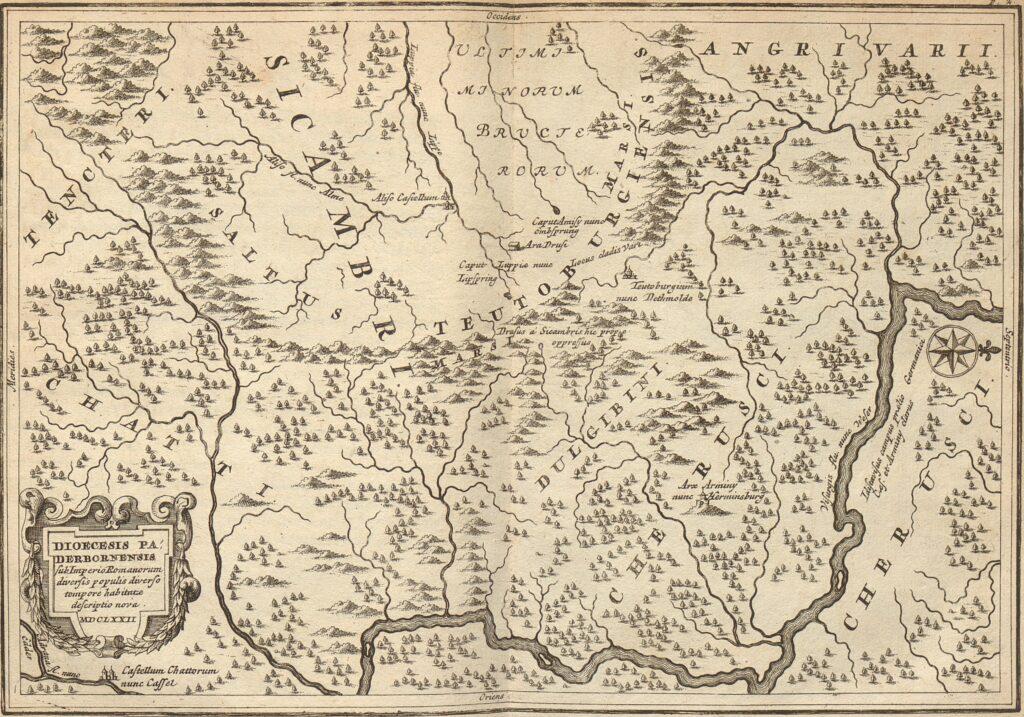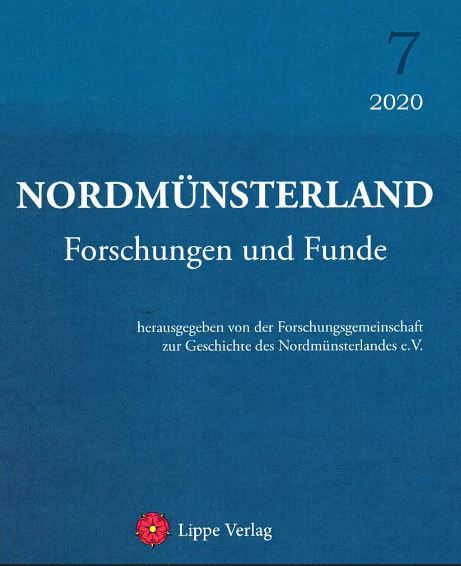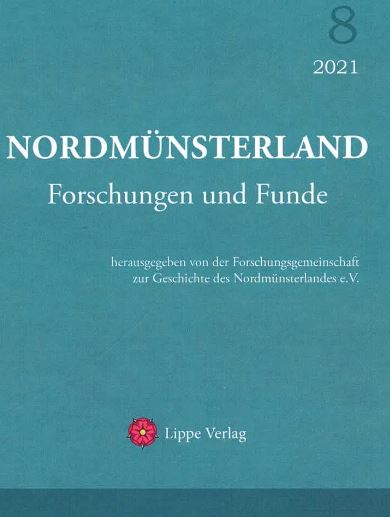Die Architekten Bloch und Guggenheimer.
Eine neue Freiluftausstellung im Innenhof des Stadtarchivs Stuttgart zeigt vom 10. Juni bis 14. November 2021 Leben und Werk der Architekten Oscar Bloch (1881-1937) und Ernst Guggenheimer (1880-1973). Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, bis Ende September auch sonntags von 11 bis 17 Uhr, frei zugänglich.
Die Lebens- und Schaffenszeit der beiden Architekten ist weit gespannt; sie reicht vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und die NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit und spiegelt die architekturgeschichtliche Entwicklung jener Jahrzehnte.
Sitz des Architekturbüros und Lebensmittelpunkt der Architekten war Stuttgart, weshalb in der Ausstellung der Fokus auf die Stuttgarter Bauten gelegt wird. Das Wirken steht in enger Verbindung mit der jüdischen Gemeinschaft in Stuttgart. Die Bauherren – auch im persönlichen Umfeld – zählten zum Netzwerk der Gemeinde, für die die Architekten Projekte vor und besonders nach 1933 realisierten. Ein städtischer Auftrag gehört zu den wenigen Ausnahmen. Dieses Netzwerk, die Biografien der Bauherren und die Geschichte der jüdischen Gemeinde sind ebenfalls Gegenstand der Ausstellung, die ein Beitrag zum 2021 begangenen bundesweiten Jubiläumsjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ ist.
Bloch & Guggenheimer
Die Architekten Bloch & Guggenheimer, die beide 1909 ihre Zweite Staatsprüfung ablegten, gründeten noch im selben Jahr ein gemeinsames Büro. Zunächst bauten sie Einfamilienhäuser, der Auftrag für die Israelitische Waisenanstalt in Esslingen (1912/13) machte sie bekannt. Es folgten vor allem Wohnbauten, Geschäftshäuser und Entwürfe für Synagogen. Der Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 beendete den Erfolg. Als Schweizer konnte Oscar Bloch zwar weiter bauen, aber vieles blieb Projekt. Nach dessen Tod führte Ernst Guggenheimer die Projekte zu Ende und musste für die Israelitische Vereinigung an der Einrichtung von Zwangsaltenheimen mitwirken. Nach Kriegsende wagte Guggenheimer die Neugründung des Büros und konnte mit der Neuen Synagoge in Stuttgart seinen wichtigsten Nachkriegsbau umsetzen.

Abb.: Neue Synagoge, Hospitalstraße 36, 1952 (Stadtarchiv Stuttgart)
Frühwerk
Im Studium lernten Bloch & Guggenheimer die neuen Ideen Theodor Fischers (1862-1938) kennen, und ihre ersten Einfamilienhäuser von 1910/11 zeigen die malerisch asymmetrischen Merkmale des aufkommenden Heimatstils.
Für die wenige Jahre später gebaute Fabrikantenvilla für Albert Levi griffen sie auf klassizistische Formen zurück und passten sich gestalterisch an kurz vorher errichtete Stuttgarter Adelsvillen an, wie beispielsweise die Villa von Gemmingen-Hornberg.
Hauptwerk
Die weithin beachtete Weißenhofsiedlung und die damit verbundene Akzeptanz des Neuen Bauens in aufgeklärten Kreisen beeinflusste auch die Arbeit von Bloch & Guggenheimer. Mit der Villa Dr. Oppenheimer am Bubenbad (1927/28) wandten sie sich vom bisherigen Stil ab. Noch deutlicher ist die Übernahme der Prinzipien des Funktionalismus am Haus Frankenstein zu sehen. Hier beherrschen verschachtelte Kuben, großzügige Fensterflächen und Terrassen die Gestaltung. In der Zeit bis 1933 konnten sie in Stuttgart und in der Zeit der Wirtschaftskrise auch in der Schweiz etliche moderne Bauten realisieren.
Biographien der beiden Architekten
Oscar Bloch (geb. 4. März 1881, gest. 6. Januar 1937)
Der in Zürich geborene Oscar Bloch zog 1883 mit seiner Familie nach Stuttgart. Nach dem Besuch des Karlsgymnasiums studierte er an Technischen Hochschule Stuttgart Architektur. 1909 gründete er mit Ernst Guggenheimer ein Architekturbüro. Bloch heiratete 1919 Alice Rothschild, das Ehepaar bekam bis 1929 drei Kinder. Nach 1933 wurde Bloch die Zulassung zur Reichskulturkammer verweigert, der Schweizer Staatsbürger konnte dennoch für jüdische Bauherrn und die Jüdische Gemeinde bauen. Er verstarb an den Folgen einer Operation in Stuttgart.
Ernst Guggenheimer (geb. 27. Juli 1880, gest. 12. September 1973)
Ernst Guggenheimer wurde in Stuttgart geboren, besuchte die Friedrich-Eugens-Realanstalt und studierte nach dem Abitur Architektur an der Technischen Hochschule Stuttgart. 1915-1918 leistete er trotz eines Gehörleidens freiwillig Kriegsdienst. Guggenheimer heiratete 1919 Frieda Schaper, eine Protestantin aus Hannover; der bis 1939 bestehenden Ehe entstammten zwei Söhne. Guggenheimer überlebte die Shoa in Stuttgart, zuletzt im Versteck. Er war von 1946 bis 1952 im Ausschuss sowie zeitweise im Vorstand der Israelitischen Kultusvereinigung aktiv.
Nähere Informationen zu Führungen und weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Begleitprogramms sind auf der Webseite des Stuttgarter Stadtarchivs oder im Blog des Stadtarchivs Stuttgart zu finden. Einen Eindruck vom „Making of“ der Ausstellung bekommt man außerdem durch einen Film auf dem Archiv Blog:
Das „Making of“ einer Ausstellung – „Bloch & Guggenheimer – Stuttgarter Bauten und jüdisches Leben“
Kontakt:
Stadtarchiv Stuttgart
Bellingweg 21
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 / 216-91512
Fax: 0711 / 216-91510
poststelle.stadtarchiv@stuttgart.de
Postanschrift
Kulturamt, Stadtarchiv
70161 Stuttgart
Quelle: Stadtarchiv Stuttgart, Aktuelle Veranstaltungen; Stadt Stuttgart, Pressemitteilung, 01.06.2021