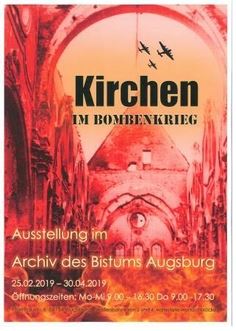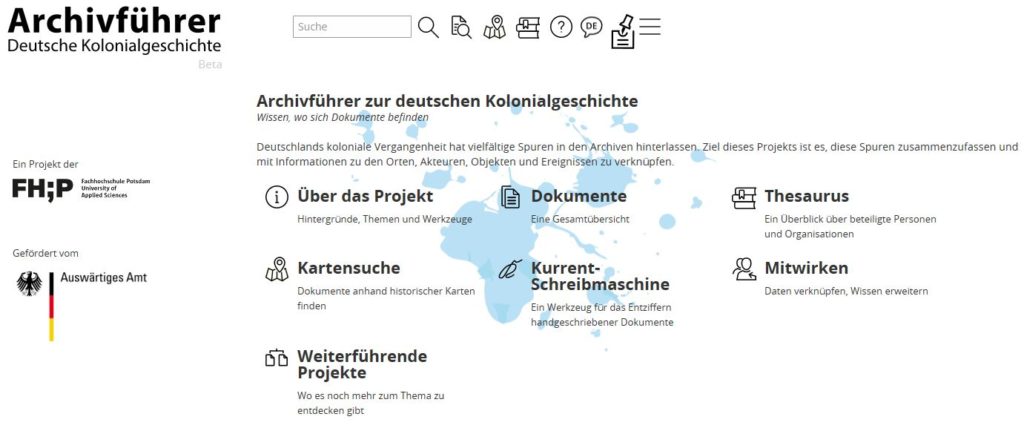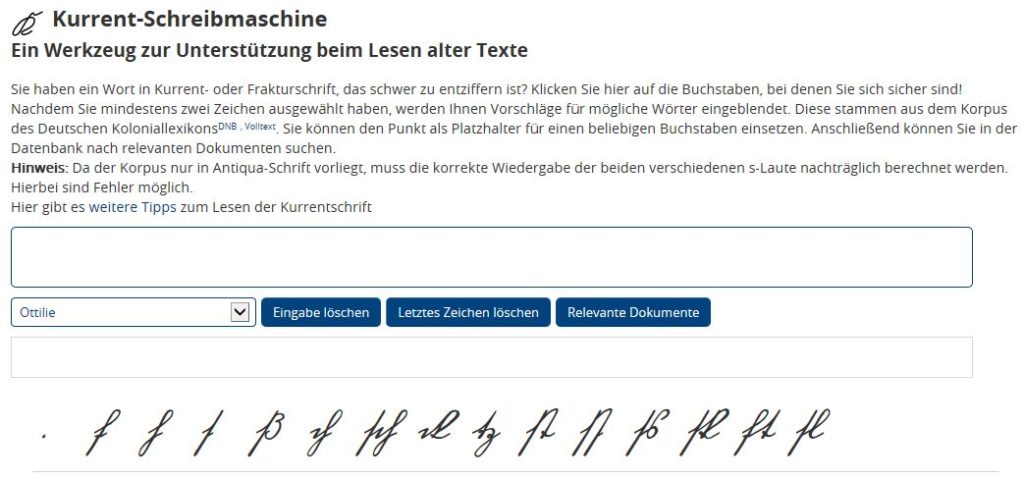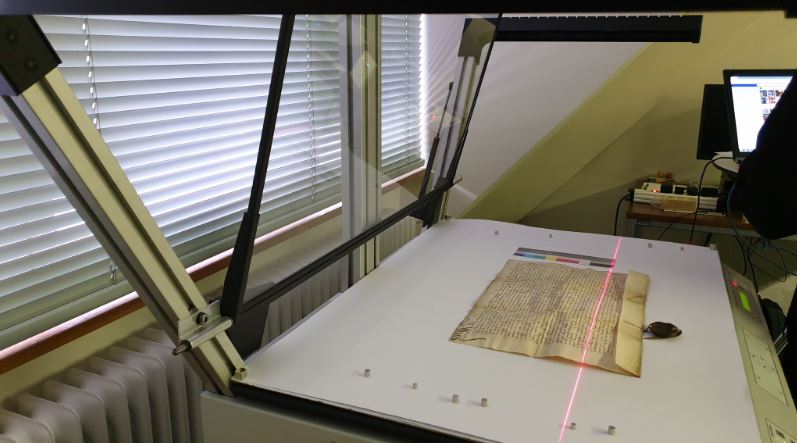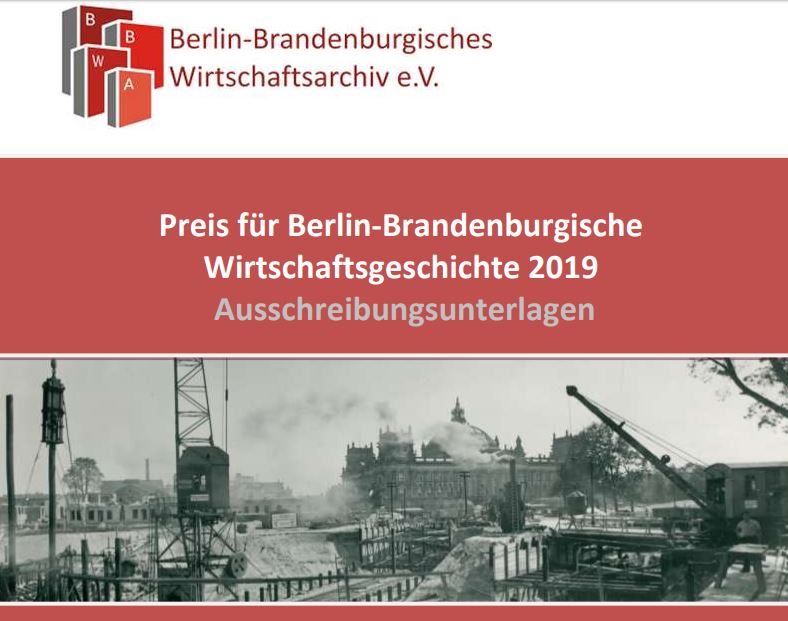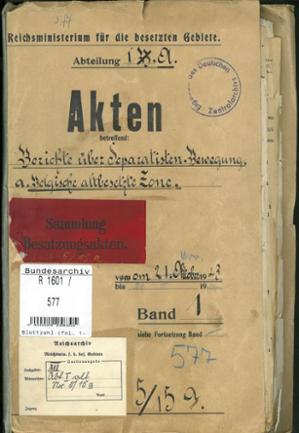Stadt Köln zieht Zwischenbilanz
Am 3. März 2019 werden Stadt Köln, Kölner Verkehrs-Betriebe und verschiedene Organisationen dem Einsturz des Historischen Archives der Stadt Köln am Waidmarkt gedenken. Vor dann exakt zehn Jahren stürzten das Gebäude des Historischen Archivs und zwei benachbarte Wohngebäude im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen des benachbarten Gleiswechselbauwerks für die künftige Nord-Süd-U-Bahn in den Untergrund. Zwei Menschen verloren ihr Leben, Anwohner mussten auf Dauer ihre Wohnungen verlassen, Schulen in Interimsstandorte ausweichen, Bewohner des anliegenden Seniorenheims ihr Heim verlassen, das Quartier Behinderungen hinnehmen, die teilweise noch andauern.

Abb.: Luftbild der Einsturzstelle mit Umgebung, 10. März 2009 (Foto: Stadt Köln)
Insgesamt 27 laufende Kilometer Archivgut wurden verschüttet und lagen teilweise im Grundwasser. 95 Prozent der Archivalien konnten mit beispiellosem Einsatz von Berufsfeuerwehr, Hilfsorganisationen aber auch freiwilligen fachfremden Helfern geborgen werden. Der finanzielle Gesamtschaden wird aktuell auf 1,3 Milliarden Euro kalkuliert. Die für den anstehenden Zivilprozess zur Schadensregulierung bedeutenden Untersuchungen am Gleiswechselbauwerk werden voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen, so dass anschließend mit dem Rückbau der temporären Bauwerke und dem aktiven Aufbau der U-Bahn-Strecke begonnen werden kann. Die strafrechtliche Bewertung der Einsturzursache wurde in den letzten Wochen durch verschiedene erstinstanzliche Urteile festgestellt. Danach beruht der Einsturz auf der mangelhaften Ausführung einer sogenannten „Schlitzwand“ zur Absicherung der Baugrube gegen Grundwasser und Erdreich durch die beauftragte Bau-Arbeitsgemeinschaft. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.
Für die Bergung des Archivgutes und anschließend die hochkomplexe Beweissicherung zur Ursachenforschung haben die Stadt Köln und anschließend die Kölner Verkehrs-Betriebe in aufwändigen technischen Verfahren zunächst ein unterirdisches Bergungsbauwerk und danach ein Besichtigungsbauwerk entlang der Schlitzwand errichtet.
Stand Archivalien-Rettung Historisches Archiv
Beim Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln am 3. März 2009 befanden sich ca. 27 laufende Kilometer Akten, ca. 62.000 Urkunden, ca. 329.000 Karten, Pläne und Plakate, ca. 500.000 Fotos und ca. 2.500 Tonträger und Videos im Archiv. In der mit Unterbrechungen zweieinhalb Jahren dauernden Bergungsphase wurden 95 Prozent davon geborgen. Zu diesem Bergungserfolg haben sowohl die Akuthilfe der Hilfsorganisationen, freiwillige Helfer, der Bau des Bergungsbauwerkes und insbesondere die Bereitschaft anderer Archive in der Bundesrepublik beigetragen, Bestände, die noch nicht in Köln untergebracht werden konnten, aufzunehmen.
Mit Stand 1. Januar 2019 konnten insgesamt 9.051 Stücke vollständig restauriert werden, darunter unter anderem 1.048 Handschriften. Allein die Restaurierung von 1.166 verschiedenen Archivalien wurde dabei durch private Spenden (mehr als 140 Patenschaften) ermöglicht. Identifiziert, also mindestens einem Bestand wieder zugeordnet, sind heute ca. 58 Prozent der geborgenen Einheiten. Insgesamt geht das Archiv von etwa 1,6 Millionen so genannter Bergungseinheiten aus. Davon haben 239.251 geborgene Einheiten – also etwa 15 Prozent von den 1,6 Millionen Bergungseinheiten – die erste Konservierungsstufe (u.a. Trockenreinigung) durchlaufen. Hiervon sind mehr als die Hälfte –fast 55 Prozent – bereits im Original (sogenannte Kategorie A) direkt wieder nutzbar und weitere 44 Prozent können zumindest als Digitalisat mittelfristig nutzbar gemacht werden (sogenannte Kategorie B).
Von Mikrofilmen und Originalarchivalien wurden mit Stand 1. Januar 2019 etwa 8,7 Millionen Dateien erstellt, so dass gegenwärtig ca. 90.000 sogenannte Verzeichnungseinheiten mit einem Digitalisat versehen sind und im virtuellen Lesesaal abrufbar sind. Allein in 2018 wurden mehr als 190.000 Originale digitalisiert.
Neben diesen Arbeiten am bisherigen Bestand und der Beseitigung der Einsturzschäden wurden seit dem Einsturz 80 neue Bestände übernommen, das heißt in fast zehn Jahren etwa 10 Prozent der Menge, die in den 150 Jahren zuvor übernommen wurde. Bereits im August 2009 erhielt das Archiv die zweite Übernahme zum Nachlass des Fotografen Charles E. Fraser. Es folgten unter anderem die Vor- und Nachlässe von Oberbürgermeister Norbert Burger (2014), Karikaturist Otto Schwalge (2017) und Talkmaster Alfred Biolek (2018).
Schon vor dem Einsturz hatte das Historische Archiv der Stadt Köln sich als Bürgerarchiv verstanden. Seine Öffentlichkeitsarbeit ist heute geprägt von mehr als 15 Ausstellungen, die seit 2010 am Heumarkt gezeigt wurden. In dieser Zeit sahen ca. 80.000 Besucher die Ausstellungen und 12.000 nahmen an den Veranstaltungen der Begleitprogramme teil. Mehr als 3.600 Personen folgen dem Facebookauftritt des Archivs seit 2015. Zum 9. Jahrestag am 3. März 2018 wurde in der Piazzetta des Historischen Rathauses der Notfallverbund Kölner Archive und Bibliotheken gegründet. Bisher haben sich in ihm 25 Verbundpartner in privater, städtischer, staatlicher und kirchlicher Trägerschaft zusammengefunden. Ziel des Verbundes ist die effektive Notfallvorsorge und gegenseitige Unterstützung im Ernstfall.
Zum zehnten Jahrestag des Einsturzes arbeitet das Historische Archiv der Stadt Köln an einem Band mit dem Titel „Geschichte mit Zukunft – 10 Jahre Wiederaufbau des Kölner Stadtarchivs“. Es handelt sich dabei um einen Sonderband in der Reihe „Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln“. Die Veröffentlichung ist für den 28. April 2019 geplant (zur Jahrestagung der Notfallverbünde am 29./30.April in Köln). Ausgehend vom Einsturz erfolgt ein detaillierter Blick auf das Archiv und zehn Jahre Wiederaufbauarbeit, eine aktuelle Bilanz von dem, was erreicht wurde, eine Darstellung der gegenwärtigen Situation und dessen, was noch kommen wird. Dabei werden alle Bereiche im Archiv thematisiert, da alle vom Einsturz und den Folgen betroffen waren oder sind. Die reich bebilderte Ausgabe wendet sich an einen breiten Leserkreis, enthält aber auch detailliertere Informationen und Bilanzen.
Rückblick
Neben dem Einsatz auf der Unfallstelle standen vor allen Dingen die betroffenen Menschen im Mittelpunkt der Bemühungen der Stadt Köln. Neben der Versorgung mit zumeist vorläufigem Ersatzwohnraum richtete die Stadt eine Anlaufstelle ein, die die persönlichen Bedürfnisse und später auch die finanziellen Aspekte der Geschädigten begleiteten. Unter anderem wurde eine neutrale Ombudsstelle eingerichtet, die die Geschädigten ansprechen konnten. Für das Quartier setzte die Stadt im Verlaufe der Arbeiten einen Quartiersmanager ein. Zu den Betroffenen gehörten neben Anwohnern auch die benachbarten Schulen. Das benachbarte Friedrich-Wilhelm-Gymnasium konnte bereits am 9. März mit mehr als 1000 Schülern in das bereitgestellte Gebäude der Volkshochschule am Neumarkt einziehen. Im Sommer 2012 erfolgte der Rückzug in das inzwischen generalsanierte Schulgebäude. Die Kaiserin-Augusta-Schule und die Schule für Sehbehinderte konnten bereits nach einem Monat wieder ihre eigenen Räume benutzen. Interimsstandorte waren Räume der Fachhochschule Köln und in der Mainzer Straße. Auch hier waren rund 1000 Schülerinnen und Schüler betroffen.
Juristische Aspekte
Die Rechtsansprüche der Stadt Köln sind Gegenstand zweier selbständiger Beweisverfahren, die vor dem Landgericht Köln anhängig sind. In dem Verfahren zur Ermittlung der Schadensursache hat der gerichtliche Sachverständige, Prof. Dr. Kempfert, im Mai 2018 drei weitere Teilgutachten (Teilgutachten VI – VIII) vorgelegt. Im Teilgutachten VIII hat er alle bisherigen Beweisergebnisse ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die von der ARGE Los-Süd hergestellte Schlitzwandfehlstelle in der Lamelle 11 unzweifelhaft die alleinige Einsturzursache vom 3. März 2009 war. Zum gleichen Schluss sind die im Auftrag der Gutachter der Staatsanwaltschaft tätigen Sachverständigen, die Herren Prof. Hermann, Azzam und Güldenpfennig, gekommen. Die beiden Strafkammern des Landgerichts Köln, die sich mit der Strafbarkeit der verschiedenen Baubeteiligten befasst haben, haben diese Auffassung ebenfalls übernommen.
In dem Verfahren zur Ermittlung der Schadenshöhe haben verschiedene Gutachter die Gebäude- und Grundstücksschäden, die Kosten zur Wiederherstellung der Bebaubarkeit des havarierten Grundstücks und schließlich auch die Restaurierungskosten für die massiv beschädigten Archivalien ermittelt. In beiden selbständigen Beweisverfahren sind von den Parteien Ergänzungsfragen zu den Gutachten gestellt worden, die derzeit von den Sachverständigen bearbeitet werden. Aufgrund der laufenden Beweisverfahren sind die Ansprüche der Stadt Köln und der KVB gegen Verjährung gesichert.
Schadenssumme
Die der Stadt Köln entstandenen Schäden sind noch nicht endgültig festgestellt. Nach aktuellem Stand geht die Stadt Köln von einem ihr entstandenen Mindestschaden von 1,33 Milliarden Euro aus. Darin enthalten sind mehr als 700 Millionen Euro für die Restaurierung der beschädigten Archivalien einschließlich des Totalverlustes von diversen Archivalien sowie verbleibender Minderwerte, ca. 80 Millionen Euro Kosten für das neue Archivgebäude, ca. 24 Millionen Euro, die für die seinerzeitige Bergungsbaugrube angefallen sind und bislang ca. 70 Millionen Euro für die Besichtigungsbaugrube.
Die Strafprozesse
Die Urteile in beiden Strafverfahren haben bestätigt, dass die ARGE Los-Süd für die entstandene Fehlstelle in der östlichen Schlitzwand verantwortlich ist. In den Strafverfahren ging es allerdings um die persönliche Schuld der beteiligten Mitarbeiter und nicht um die Haftung der ARGE und ihrer Gesellschafter.
Die noch nicht rechtskräftigen Freisprüche der beiden Bauleiter der ARGE Los-Süd bedeuten auch nicht, dass die Verantwortlichkeit der ARGE ausgeschlossen oder eingeschränkt wäre. Im Gegenteil: Das Strafgericht hat im ersten Strafverfahren festgestellt, dass den beiden freigesprochenen Bauleitern erhebliche Pflichtverletzungen anzulasten sind. Im zweiten Strafverfahren wurde ein Bauoberleiter der ARGE Los-Süd verurteilt. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte den Einsturz bei pflichtgemäßem Handeln hätte verhindern können.
Beide Urteile stützen damit die bisherige Position der Stadt und der KVB, wonach die ARGE Los-Süd die alleinige Verantwortung für die Havarie trägt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich hieraus keine Bindungswirkung im Hinblick auf die zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche ergibt.
Aktuelle gutachterliche Untersuchungen auf der Einsturzstelle Waidmarkt
Der von der Stadt Köln beauftragte Sachverständige Prof. Kempfert hat in seinem Teilgutachten VIII festgestellt, dass die von der ARGE Los-Süd hergestellte Fehlstelle in der östlichen Schlitzwand die alleinige Einsturzursache darstellt. Unbeschadet dieser Feststellungen hat die ARGE Los-Süd dargelegt, die von ihr hergestellte Fehlstelle in der östlichen Schlitzwand sei entweder überhaupt nicht ursächlich für den Einsturz vom 3. März 2009 oder allenfalls in Verbindung mit anderen Ursachen. Zum sicheren Ausschluss solcher alternativer Schadensszenarien hatte der Sachverständige Prof. Kempfert deshalb vorgeschlagen, die restlichen Bodenschichten in der Besichtigungsbaugrube bis zur Braunkohle noch auszuheben. Auf dieser Basis hat das Landgericht Köln im Juli 2018 beschlossen, dass der Sachverständige Prof. Kempfert diese ergänzenden Erkundungsarbeiten durchführen soll. Die weiteren Bodenschichten bis zur Tiefe von 15,50 mNN sind inzwischen von Herrn Prof. Kempfert untersucht worden, ohne dass sich Anhaltspunkte für andere Schadens-ursachen ergeben hätten. In einigen Wochen steht die Freilegung und Untersuchung der Braunkohleschicht an. Die Stadt Köln rechnet damit, dass auch die Überprüfung der Braunkohleschicht keine Anhaltspunkte für alternative Schadensszenarien ergibt. Die Beweisaufnahme am Waidmarkt kann also voraussichtlich noch im Jahr 2019 endgültig abgeschlossen werden, ohne dass irgendwelche Zweifel bezüglich der Einsturzursache bleiben.
Vorsorglich weist die Stadt Köln darauf hin, dass die nachlaufenden und voraussichtlich im Jahr 2019 abzuschließenden Untersuchungen die Sanierung des Gleiswechselbauwerks nicht verzögern. Derzeit läuft noch die Sanierungsplanung der ARGE Los-Süd, die voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen ist. Wenn die entsprechende Genehmigung durch die Bezirksregierung vorliegt, kann voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 mit der Ausführung der Sanierungsarbeiten begonnen werden. Die Sanierung des Gleiswechselbauwerks und die vollständige Inbetriebnahme der U-Bahn werden also durch die nachlaufenden Erkundungen des Sachverständigen Prof. Kempfert nicht verzögert.
Schadenersatz
Eine Schadensersatzklage der Stadt Köln (und der KVB) gegen die Schädiger, insbesondere die ARGE Los-Süd, ist noch nicht eingereicht. Stadt Köln und KVB werden nach rechtskräftigem Abschluss der Strafverfahren und nach endgültiger Schadensfeststellung mit der ARGE Los-Süd und deren Haftpflichtversicherungen in Kontakt treten. Dieses setzt allerdings voraus, dass die ARGE Los-Süd ihre Verantwortlichkeit für den Einsturz und die damit verbundenen Schäden und Kosten akzeptiert. Die Stadt Köln geht davon aus, dass Schadenersatzansprüche durch das Unternehmensvermögen der ARGE-Gesellschafter sowie deren Haftpflichtversicherungen abgegolten werden können, ergänzend auch durch zusätzlich vereinbarte Sicherheiten.
Leihgeber
Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln sind mehrere Verfahren anhängig, in denen Leihgeber von Archivalien Ansprüche gegen die Stadt Köln wegen der Beschädigung beziehungsweise des Verlustes eingelagerter Archivalien geltend machen. Das OLG Köln hat diese Verfahren ausgesetzt, um die Ergebnisse der Gutachten und den Ausgang der Strafverfahren abzuwarten. Die Stadt Köln geht davon aus, dass nach (erstinstanzlichem) Abschluss der beiden Strafverfahren und nach Vorlage der verschiedenen Sachverständigengutachten nun zeitnah eine Fortsetzung dieser Leihgeberverfahren stattfinden wird.

Abb.: Neubau Luxemburger Straße/Ecke Eifelwall (Foto: Stadt Köln)
Neubau Historisches Archiv
Der Neubau für Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv am Eifelwall schreitet zügig voran. Die Fassade der Mantelbebauung ist im Wesentlichen fertiggestellt, die Schlussabnahme für den Rohbau erfolgt. Geplant ist es, das Gebäude im vierten Quartal 2020 funktionsfähig an den Nutzer zu übergeben. Es stehen lediglich noch zwei Vergaben aus. Für die Brunnenanlage soll die Beauftragung in Kürze erfolgen, die Ausschreibung für die Außenanlagen gehen in Kürze auf den Markt.
Am Eifelwall errichtet die Stadt Köln Europas modernstes kommunales Archiv, in dem das Historische Archiv der Stadt Köln und das Rheinische Bildarchiv ihren neuen Platz finden. Bauherrin ist die städtische Gebäudewirtschaft. Gebaut wird nach den Plänen des Architekturbüros Waechter + Waechter Architekten aus Darmstadt eine dreigeschossige Mantelbebauung, in dessen Mitte sich das so genannte Schatzhaus erhebt, das mit seinen Magazinen die Archivalien und Fotografien schützt. Auf einer Gesamtfläche von etwa 22.584 Quadratmetern stehen rund 50 Regalkilometer und 460 Planschränke für das Archivgut zur Verfügung. Das Rheinische Bildarchiv bekommt weitere 2,2 Regalkilometer Lagerfläche. Es bietet gleichzeitig rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochfunktionale Arbeitsplätze. Im Lesesaal stehen 45 Plätze für die Arbeit mit Archivgut zur Verfügung. Der Neubau Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv ist mit Gesamtkosten von rund 75,9 Millionen Euro (zuzüglich zehn Prozent Risikoreserve) veranschlagt.
Sanierungsplanung und Fertigstellung des Gleiswechselbauwerks
Im Zuge einer ersten Planungsstufe (Grundlagenermittlung bis Vorplanung) wurden durch die Arge Los-Süd in Abstimmung mit der KVB AG und der Stadt Köln fünf Sanierungsvarianten erarbeitet und Anfang diesen Jahres der KVB und Verwaltung vorgelegt.
Von diesen fünf Sanierungsvarianten haben die KVB AG und die Verwaltung für die weitere Entwurfs- bis Ausführungsplanung zwei Varianten ausgewählt, die dem Rat im April 2019 zur Entscheidung für die Fortführung der Sanierungsplanung in einer zweiten Planungsstufe vorgelegt werden sollen.
Bei diesen beiden Sanierungsvarianten handelt es sich jeweils um eine Planungsvariante, die eine reine Sanierung ohne weitere Berücksichtigung möglicher zusätzlicher Beweiserhebungen zur Ursache des havarierten Gleiswechselbauwerkes bietet und um eine zweite Planungsvariante, die eine Option für eine spätere ergänzende Beweiserkundung in einem Teilbereich im Inneren des havarierten Bauwerkes parallel zur Ausführung der Sanierungsarbeiten zulässt. Die Option einer Beweiserkundung im Inneren des havarierten Gleiswechselbauwerks soll so lange bestehen bleiben, bis die durch den Sachverständigen Prof. Kempfert eindeutig festgestellte Schadensursache durch seine aktuell fortgeführte ergänzende Beweiserkundung bestätigt wird. Die konkrete Weiterplanung wird sodann zwischen KVB AG und der Verwaltung abgestimmt, sodass nach Abschluss der Ausführungsplanung ein weiterer Ratsbeschluss zur baulichen Umsetzung einer finalen Sanierungsvariante erfolgen wird.
Mit einem Baubeginn der Sanierungsarbeiten wird Mitte 2020 zu rechnen sein, mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der 1. Baustufe wird , in Abhängigkeit vom Verlauf der weiteren Planung und Bauausführung frühestens in 2026/2027 gerechnet
Waidmarkt – weitere Entwicklung
Bis auf die anstehende Schulerweiterung im hinteren Teil des Geländes, die für dieses Jahr geplant ist, sind alle anderen Überlegungen zur Zukunft des Geländes der Einsturzstelle abhängig von der Sanierung des Gleiswechselbauwerkes und welche Auswirkungen dies auch auf die oberirdischen Flächen hat. Das gilt auch für den Ort des Gedenkens. Es wird einen würdigen Ort des Gedenkens an dieser Stelle geben. Die Stadt Köln wird sowohl zu dem Ort des Gedenkens als auch zu der Gesamtgestaltung und Nutzung des Geländes in einen intensiven Bürgerdialog eintreten. Dieser Dialog soll dann beginnen, wenn verlässliche Daten über die möglichen Flächen vorliegen.
Kontakt:
Historisches Archiv der Stadt Köln
Heumarkt 14
50667 Köln
Postfach 10 35 64
50475 Köln
Quelle: Stadt Köln, Pressemitteilung, 22.2.2019