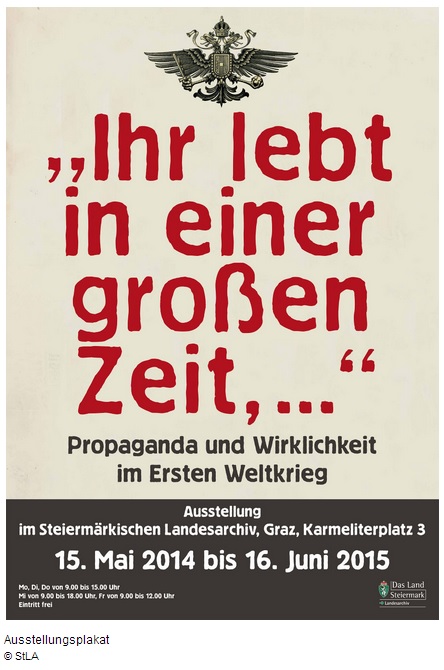Erstmals widmete sich eine Archivpädagogenkonferenz mit dem Thema „Reformation“ einem einzigen inhaltlichen Schwerpunkt. Die 28. Archivpädagogenkonferenz, die am 23. und 24. Mai 2014 in Weimar stattfand, beschäftigte sich mit dem Einsatz frühneuzeitlicher Quellen in7 Archivpädagogik und Historischer Bildungsarbeit, also nicht zuletzt: im schulischen Unterricht.
Die Konferenz, die mit einer Führung durch das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar begann, fand im Herderzentrum statt, dem im Sommer 2013 eröffneten zentralen kirchlichen Veranstaltungsort in direkter Nachbarschaft zur Stadtkirche St. Peter und Paul (sog. „Herderkirche“). Die traditionell enge Zusammenarbeit zwischen dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Weimar und dem Hauptstaatsarchiv Weimar, das die Archivpädagogenkonferenz für den VdA-Arbeitskreis Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit organisiert und durchgeführt hat, drückte sich in den einleitenden Grußworten von Superintendent Henrich Herbst und von Staatsarchiv-Direktor Dr. Bernhard Post, aber auch in jenen von Dr. Christina Kindervater (Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) und Dr. Andreas Jantowski (Direktor des Thillm in Bad Berka) aus. Sie betonten die Notwendigkeiten und Möglichkeiten quellengestützten Lernens für die kritische Rezeption historischer Traditionsbestände, die in Thüringen als Kernland der Reformation anhand zahlloser authentischer Quellen und Orte stattfinden kann. Sie wiesen dabei darauf hin, dass die kritische Geschichtsaneignung gerade in Weimar eine besondere Chance beinhalte, aber auch Verantwortung impliziere, da hier nicht nur die Geistesgrößen der deutschen Klassik, wie Goethe, Schiller, Wieland und Herder, öffentlich gewirkt hätten, sondern auch schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit offen praktiziert wurden – woran unter anderem die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald erinnert.

Abb.: Teilnehmende an der 28. Archivpädagogenkonferenz sowie Ltd. Archivdirektor Dr. Bernhard Post (Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar) bei seiner Begrüßung (Foto: Susanne Freund, Potsdam)
Die Fachvorträge des ersten Konferenztages bauten sinnvoll aufeinander auf. Zunächst präsentierte Prof. Dr. Anke John (Geschichtsdidaktik Universität Jena) empirische Befunde zum Quelleneinsatz im Geschichtsunterricht. Grundlage bildeten zwei Schullehrbücher in ihren Thüringer Ausgaben: „Geschichte und Geschehen 7/8“ sowie „Das waren Zeiten 2“. Schulbücher stellen immer noch das „Leitmedium“ dar, zumal Lehrerinnen und Lehrer mit anderen Medien nicht derart vollumfänglich vertraut seien, wie John am Beispiel Historischer Spielfilme (hier: dem Spielfilm „Luther“ von 2003) aufzeigte. Der Unterricht habe es zu leisten, Legenden um Luther bzw. des Lutherbildes zu hinterfragen und die Unterscheidung von Quelle und Deutung zu ermöglichen. John konstatierte eine „Rekonventionalisierung der Geschichtsvermittlung“ und kritisierte, dass Bildquellen häufig nur illustrativ eingesetzt würden. Im Rahmen von „Methodentrainings“ zum Filmeinsatz müssten hingegen Absichten von Bildern sowie Beziehungen von Bildelementen erkannt und herausgearbeitet werden. Bei der Quellenauswahl für die Thüringer Geschichtsbücher zeige sich zudem, dass die regionalgeschichtliche Konkretion von Themen zugunsten der europäischen Dimension verloren gehe. Auch kämen Gender-Perspektiven zu kurz. Dem ließe sich begegnen, indem z.B. auf die Beteiligung von Frauen an der Reformation wie an der Gegenreformation hingewiesen werden würde: als Flugfschriftenautorinnen, als Predigerinnen oder als Dichterinnen. Johns empirischen Befunde verdeutlichten, dass der Einsatz von Bildquellen und von Textquellen ein sehr unterschiedliches Profil habe. Das zeige sich beispielsweise in der höheren Aufmerksamkeit, die Bildquellen gemeinhin erführen, aber auch in der längeren Bearbeitungszeit für Textquellen. Empirisch belegbar sei, so fasste John abschließend zusammen, dass es einen hohen Nutzen von Quellenarbeit im Geschichtsunterricht gebe, wenn es um die Faktoren Wissensvermittlung, Einnehmen von unterschiedlichen Perspektiven, Umgang mit Quellen sowie Konstruktion von Geschichte gehe.
Dagmar Blaha, die die Abteilung für ältere Bestände im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar leitet, konnte diese Befunde aufgreifen und ein neues Produkt für die Nutzung reformationsgeschichtlicher Quellen im Schulunterricht präsentieren: das Digitale Archiv der Reformation. Ab Ende 2015 werden in einer Internetplattform reformationsgeschichtliche Schriftzeugnisse aus Staatsarchiven „Mitteldeutschlands“ präsentiert und digital nutzbar gemacht. Projektbeteiligt sind die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Es sollen ganz unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden, von interessierten Bürgern bis hin zu Wissenschaftlern, für die aber jeweils unterschiedliche Module bereit gestellt werden (so ein „Forschungsmodul“ und ein „Wissensmodul“). Zunächst sollen 119 intensiv aufbereitete Dokumente, z.B. umfangreiche Visitationsprotokolle, sowie zudem „Schlüsseldokumente“ der Frühen Neuzeit präsentiert werden. Das Angebot wird dabei neben dem Digitalisat auch Kurzregesten (mit Signatur), Abschriften, Übertragungen in modernes Deutsch, historische Einführungen und nach Möglichkeit auch Übersetzungen ins Englische umfassen. Das Portal „DigiRef“ ist ausbaufähig und soll perspektivisch neben Schriftzeugnissen auch digitalisierte Fotos und Baudenkmäler etc. beinhalten. Der Einsatz der mehrstufig erschlossenen Quellen wird sich vermutlich gut für Schulen eignen, Wissenschaftler werden hingegen ihre eigene Quellenauswahl treffen wollen und auch weitere Bestände zur Kontextualisierung ihrer jeweiligen Fragestellungen vor Ort in den Archiven nutzen müssen.
Im dritten Fachvortrag des Tages benannte Rigobert Möllers vom Arbeitsbereich „Medien und Informationstechnologien“ der Thillm die Aktivitäten dieses „Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien“ (Bad Berka) im Rahmen der Lutherdekade. Er will Originalquellen sowie deren Digitalisate als „Zumutung“, also als positiv verstandene Herausforderung für Schülerinnen und Schüler verstanden wissen. In seinem sehr engagierten Vortrag, der implizit die Anteile politischer Bildungsarbeit in der Geschichtslehrerfortbildung verdeutlichte, stellte er die Luther-Wanderausstellung des Thillm in ihrer animierten, dreidimensional online-gestellten Form vor. Mit ihr könne man lernen (und lehren), den Freiheitsbegriff Luthers differenziert zu betrachten: als individuelle Freiheit und als gesellschaftliche Verantwortung. So leiste die Ausstellung jene für die Pädagogik notwendige Verbindung aus problemorientierter Aufbereitung historischer Probleme und deren lebensweltlicher Adaption. In der Ausstellung werden das geistliche und das weltliche Regiment in je drei Stelen vorgestellt (2 x Glaube und Freiheit, Kirche und Welt, Mensch und Kultur, Sprache und Medien, Erziehung und Schule). – Dass angesichts des bevorstehenden Reformationsjubiläums 2017 die besondere Chance für die unterrichtliche Befassung mit frühneuzeitlichen Quellen gerade darin liege, dass man es nicht mit einem solitären Reformationsereignis, sondern mit einem langen Reformationsprozess im 16. und 17. Jahrhundert zu tun habe und dass man die ausgerufene „Lutherdekade“ bis zum Jubiläumsjahr eher als „Reformationsdekade“ auffassen müsse, kam an verschiedenen Stellen der Archivpädagogenkonferenz zum Ausdruck.
Traditionell beschliesst eine Runde der Konferenzteilnehmer mit eigenen kurzen „Berichten aus den Archiven“ den ersten Konferenztag. In diesen knappen Jahresrückblicken wurde beispielsweise auf das Angebot von Erarbeitungsvorschlägen modularer Art für Lehrerinnen und Lehrer als Service von Archiven bzw. Archivpädagogen hingewiesen (so im Staatsarchiv Hamburg, im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden oder im Landesarchiv NRW Abt. Detmold). Aufgrund großer Nachfrage hat das Stadtarchiv Hilden zusammen mit der dortigen VHS eine „Stadtführerausbildung“ für Senioren etabliert. Das Stadtarchiv bereitet zudem Thementafeln für „Haltestellen“-Geschichten auf, die den Wartenden an Bushaltestellen insbesondere biografische Hintergründe der Namenspatrone der jeweiligen Hildener Haltestellen liefern. Das Westfälische Wirtschaftsarchiv in Dortmund hat einen „Archivführerschein“ für Lehrerinnen und Lehrer der gymnasialen Oberstufe entwickelt. Das Historische Archiv der Stadt Köln interaktive Führungen, in denen beispielsweise Fließbandarbeit in einer Werkshalle nachgestellt wird. Und im Landesarchiv Baden-Württemberg geht man derzeit an die Planungen für die nächsten Karlsruher Tagung zur Archivpädagogik, die dort am 6.3.2015 stattfinden wird.
Am zweiten Tag der 28. Archivpädagogenkonferenz in Weimar ging es im Rahmen dreier Fachvorträge um Praxisbeispiele der Geschichtsvermittlung in Schule, Kirchenarchiv und Stadtmuseum: Heike Fiedler, die vom Grabbe-Gymnasium in Detmold stundenweise an die dortige Landesarchiv-Abteilung abgeordnete Archivpädagogin, und Tobias Knecht, derzeit Studienreferendar am Gymnasium Leopoldinum in Detmold, zeichneten im Rahmen ihrer „Reflexion zum Lernen im Archiv am Beispielen von Zeugnissen der Reformation in Lippe“ eine aktuelle gemeinsame Unterrichtsreihe nach. Wichtig war ihnen, dass dieses Pilotprojekt sorgfältig an die jeweiligen infrastrukturellen Voraussetzungen und inhaltlichen Bedürfnisse der Partner Schule und Archiv angepasst wurde. Die Unterrichtsreihe zielte auf die gleichsam vertikale Progression in der Fachwissenvermittlung ab – vom Sachurteil bis hin zum abschließenden Werturteil über die Religionsfreiheit als Menschenrecht. An historischen Quellen standen aus Gründen der didaktischen Reduktion zwei Dokumente im Zentrum. Sie sollten zudem den Beginn und den Abschluss der zeitgenössischen Entwicklung repräsentieren: Zu Beginn wurde ein Ablassbrief für Simon V. zur Lippe aus dem Jahr 1515 genutzt, im weiteren Verlauf dann der – im original 16 Seiten umfassende – Röhrentruper Rezess von 1617, mit dem sich der reformierte Graf zur Lippe und die lutherische Stadt Lemgo verglichen. Insgesamt 14 Unterrichtsdoppelstunden, von denen zwischen Ende März und Anfang Mai 2014 sechs in der Schule und acht im benachbarten Archiv durchgeführt wurden, widmeten sich in verschiedenen Modulen den archivischen Methoden und historischen Inhalten. Das von beiden Seiten (sowie insbesondere von der beteiligten Lerngruppe) als sehr gelungen bezeichnete Unterrichtsprojekt war von Zwischen- und Abschlussevaluationen begleitet worden, so dass deren differenzierte Ergebnisse auch als Handreichung für vergleichbare Projekte dienen können.
In ihrem anschließenden Vortrag zeigte Dr. Hannelore Schneider, die mit ihrem Landeskirchenarchiv in Eisenach jüngst einen neuen Standort beziehen konnte, wie sie mit wenig Mitteln und Kapazitäten für die Archivpädagogik dennoch ihrem Interesse an einer schulischen Begegnung mit dem Archiv nachzukommen versucht. Neben einem Seminarraum, der ihr nunmehr im neuen Gebäude zur Verfügung steht, verfügt sie über einen alten Schrank (aus dem Historismus). Hier, unter anderem in einem eingebauten Geheimfach, hinterlegt sie archivisches Schaumaterial, um mit Schülern anschließend gemeinsam „Geschichte aus dem Schrank“ heben zu können. Als naheliegende Kooperationspartnerin für die Kirchenarchivpädagogik bietet sich nunmehr die benachbarte Evangelische Grundschule an, für die Schneider im Zuge der Archivbauarbeiten extra eine eigene Gartenpforte auf das Archivgelände in den Zaun hat einbauen lassen. Dadurch ist ein kurzer Weg ins Archiv – und in die Geschichte – gewährleistet.
Ganz andere Bedingungen für die Geschichtsvermittlung besitzt naturgemäß ein Stadtmuseum: Gudrun Noll-Reinhardt, Stadtarchäologin vom Stadtmuseum Erfurt, präsentierte im abschließenden Vortrag der Archivpädagogenkonferenz, das von ihr und Museumsdirektor Hardy Eidam entwickelte „Geschichtslabor“ vor, einer Ausstellung zum komplexen Thema „Rebellion – Reformation – Revolution„, die am Reformationstag 2012 im Stadtmuseum Erfurt eröffnet wurde. Noll-Reinhardt, die im Zuge der Ausstellung, die sie kuratierte, auch museumspädagogische Kompetenz erwarb, führte die Konferenzteilnehmer virtuell durch die platzgreifende Ausstellung, die sie als „installative Konfrontation von Geschichte und Gegenwart“ verstanden wissen will. Das Museum bietet Platz und Gelegenheit für eine kreative Aneignung von Geschichte. Einerseits werden in eher klassischer Form Erfurt, wo Martin Luther zwischen 1501 und 1511 gelebt und studiert hatte, als „Wiege“ der Reformation vorgestellt. Andererseits führen eindrucksvolle, großformatige Installation verschiedene Fragehinsichten an (z.B. „Ich und das Andere?“), mit denen das Fortwirken reformatorischer Errungenschaften im eigenen Leben überprüft werden kann. Das Stadtmuseum erinnert mit dieser Ausstellung en passant daran, dass die Reformation, wenn man dabei den Fokus von Erfurt auf Wittenberg aufzieht, zunächst ein Universitätsereignis gewesen ist, der man die Entwicklung einer kritischen und unabhängigen Wissenschaft zu verdanken hat.
Im Anschluss an eine Konferenzzusammenfassung der Koordinatorin des VdA-Arbeitskreises Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit, Dr. Annekatrin Schaller (Stadtarchiv Neuss), die zugleich die nächste, die 29. Archivpädagogenkonferenz 2015 in Koblenz avisierte, bot Hausherr Dr. Bernhard Post den Teilnehmern eine kurzweilige Führung durch das Hauptstaatsarchiv Weimar und seine beeindruckenden Bestände, die in der aktuellen Archivausstellung zur Geschichte der Pädagogik in Thüringen endete und eine Generalprobe für die anschließende Lange Nacht der Museen in Weimar darstellte. Die von Katrin Göring, Ina Maletz und weiteren Mitarbeitenden des Hauptstaatsarchivs Weimar professionell und liebevoll organisierte 28. Archivpädagogenkonferenz gab den mehr als 40 Teilnehmern, darunter erneut einige Studierende der FH Potsdam, etliche Anregungen nicht nur zum Einsatz frühneuzeitlicher Archivquellen im Unterricht mit auf den Heimweg. Angesichts dieses Potenzials an motivierten und kompetenten Menschen, vielfältigen Archivbeständen und behördlicher Einsicht in die Notwendigkeit von Archivpädagogik ist es kaum erklärbar, dass es in Thüringen und manch anderen Bundesländern die zwischenzeitlich an die Staatsarchive abgeordneten Archivpädagogen nicht mehr gibt.
Jens Murken, Bielefeld