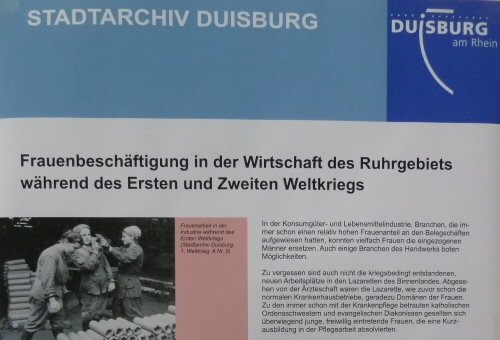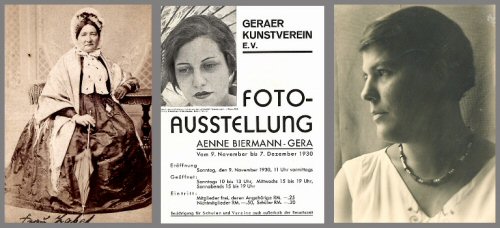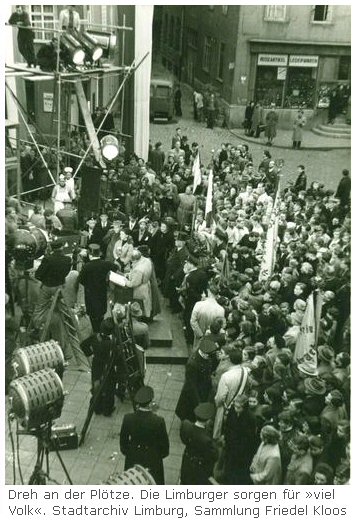Am 3. März 2014 jährte sich zum fünften Mal der Tag, an dem das Historische Archiv der Stadt Köln einstürzte und zwei Menschen in den Tod riss. Der Einsturz steht vermutlich im Zusammenhang mit Bauarbeiten an einem unterirdischen Gleiswechselbauwerk der Neubaustrecke der Nord-Süd-Stadtbahn. Noch in diesem Jahr werden belastbare Erkenntnisse zur Einsturzursache erwartet.
Oberbürgermeister Jürgen Roters hat für die Stadt Köln am Einsturzort am Waidmarkt am 3. März 2014 mit einer Kranzniederlegung der Opfer des Einsturzes gedacht und an die Folgen für Betroffene, Anwohnerinnen und Anwohner sowie das kulturelle Erbe der Stadt Köln und die Stadtgesellschaft erinnert. Verschiedene private Organisationen und Initiativen begleiten diesen Tag mit weiteren Kundgebungen und Aktionen.
Mit dem Gebäude des Historischen Archivs stürzten über 30 Regalkilometer Archivgut in die Tiefe. Zwei Menschen verloren ihr Leben, über 30 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Schülerinnen und Schüler benachbarter Schulen mussten zeitweise provisorische Schulräume beziehen.
Fünf Jahre danach konnten viele unmittelbare Folgen des Einsturzes zumindest gemildert werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sind in ihren neuen Wohnungen "angekommen". Das Quartier von der Severinstraße bis zum Waidmarkt erholt sich weiterhin von den Beeinträchtigungen, die Schulen sind nach der Grundrenovierung wieder in Betrieb. 95 Prozent der Archivalien sind geborgen und gesichert. Einiges ist bereits restauriert und steht der Wissenschaft wieder zur Verfügung. Eine Teilstrecke der Nord-Süd-Stadtbahn ist in Betrieb genommen worden.
Stadt erwartet Aussagen zur Schadensursache noch in 2014
Die Kranzniederlegung an der Einsturzstelle am Waidmarkt, vorgenommen von Oberbürgermeister Jürgen Roters, gehörte zu einer Reihe von Veranstaltungen, in denen Köln den Opfern des Einsturzes des Historischen Archivs in Köln gedenken wird. Neben der protokollarisch offiziellen Kranzniederlegung exakt fünf Jahre nach dem Einsturz erinnern eine Reihe von Veranstaltungen und Gottesdiensten an dieses Unglück. Nachdem die Bergung der letzten, durch den Einsturz verschütteten Archivalien im Herbst 2012 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, haben Stadt Köln und Kölner Verkehrsbetriebe nach den Vorgaben des gerichtlich bestellten Sachverständigen und im Auftrag des Landgerichts Köln vor der östlichen Schlitzwand des Gleiswechselbauwerks ein sogenanntes Besichtigungsbauwerk errichtet, durch das in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln die Ursache des Einsturzes geklärt werden soll. Der Aushub innerhalb dieses Bauwerks hat begonnen. Mit konkreten Aussagen zur Ursache des Einsturzes durch die Gutachter der Staatsanwaltschaft und der Gerichte rechnet die Stadt Köln noch in diesem Jahr. Die Stadt Köln bereitet sich zur Durchsetzung ihrer Ersatzansprüche auf einen Schadenersatzprozess mit einer Schadenssumme von rund 1 Milliarde Euro vor. Neben eigenen Schäden verfolgt die Stadt Köln auch die Interessen zahlreicher, durch den Einsturz geschädigter Leihgeberinnen und Leihgeber des Historischen Archivs.
Am 3. März 2009 stürzte im Zusammenhang mit Bauarbeiten an einem unterirdischen Gleiswechselbauwerk der geplanten U-Bahnstrecke der Nord-Süd-Stadtbahn das Gebäude des Historischen Archivs der Stadt Köln ein. Mitgerissen wurden weitere benachbarte Gebäude. Zwei Menschen verloren ihr Leben. Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Wohnungen, benachbarte Schulen ihre Räume verlassen.
Rund 30 Regalkilometer Zeugnisse Kölner und Rheinischer Geschichte durchmischten sich mit den eingestürzten Wänden und Decken des Archivs zu einem unterirdischen und oberirdischen Schuttberg. 95 Prozent der Archivalien konnten in einer beispiellosen Anstrengung von Einsatzkräften der Hilfsorganisationen, freiwilligen Helferinnen und Helfern und mit Hilfe eines technisch anspruchsvollen Bergungsbauwerks oberhalb und unterhalb des Grundwasserpegels geborgen werden und wurden zunächst in knapp 20 Asylarchiven in der gesamten Bundesrepublik zwischengelagert. Zwei Drittel der Archivalien sind inzwischen wissenschaftlich erfasst und archivgutgerecht eingelagert. Die Stadt Köln errichtete in Köln-Porz ein neues Restaurierungszentrum für das Historische Archiv, sukzessive können Archivalien wieder aus Asylarchiven nach Köln zurückgeholt und der Forschung wieder bereitgestellt werden. 6.500 Archivalien konnten dort bisher konservatorisch behandelt werden. Geplant ist, noch in diesem Jahr einen Großteil der auswärts gelagerten Archivalien in dem ehemaligen Gebäude des Landesarchives in Düsseldorf und damit in unmittelbarer Nähe Kölns zu konzentrieren. Mit den Vorarbeiten für den Neubau des Historischen Archives in Köln am Eifelwall soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.
Ein Überblick über die vergangenen fünf Jahre:
Anwohner und Betroffene
Durch den mutigen Einsatz von Mitarbeitern beteiligter Unternehmen und des Historischen Archivs konnten Besucher des Historischen Archivs, Passanten, Schüler und Anwohner wenige Minuten vor dem Einsturz so frühzeitig gewarnt werden, dass sie den unmittelbaren Gefahrenbereich verlassen konnten. Zwei Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses verloren im zusammenstürzenden Gebäude jedoch ihr Leben.
36 Anwohner der Nachbarhäuser verloren ihre Wohnungen. Über 40 Mitarbeiter des städtischen Wohnungsversorgungsbetriebs kümmerten sich sofort um die persönlichen Belange der Betroffenen, alle erhielten sofort einen eigenen "Assistenten". Die Betroffenen sind inzwischen mit neuem Wohnraum versorgt und weitgehend in ihrem neuen "Leben" angekommen. Das vom psychologischen Betreuungsteam der Feuerwehr, später vom Psychosozialen Dienst des Gesundheitsamtes betreute Betreuungsprogramm für ursprünglich 180 Personen wird heute nicht mehr in Anspruch genommen. Wenige Einzelfälle benötigen noch privat organisierte Betreuung. Der von der Stadt Köln zur Unterstützung für die Betroffenen in allen Rechts- und Entschädigungsfragen vorgeschlagene Ombudsmann konnte seine Arbeit inzwischen beenden.
Das Gelände eines ehemaligen Nachbargebäudes wurde von der Stadt Köln angekauft, ein zweites Grundstück wird gemeinsam mit dem Eigentümer in eine geplante künftige Bebauung einbezogen.
Die finanziellen Entschädigungen für die unmittelbar Betroffenen wurden über die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) geregelt.
Als Entschädigung für die Beeinträchtigungen durch die laufenden Arbeiten an der Einsturzstelle hat die Stadt Köln finanzielle Vereinbarungen für die unmittelbar betroffenen 40 Anwohner getroffen. Zwischen der Stadt Köln und den Anwohnern besteht ein regelmäßiger Informationsaustausch. Die Belange des Quartiers incl. der Geschäftswelt auf der Severinstraße vertritt der von der Stadt Köln eingesetzte Veedelsmanager. Er ist Ansprechpartner und Verbindungsmann zwischen dem Viertel, KVB und Stadt Köln.
Schulen
Von den Folgen des Einsturzes waren auch die benachbarten Schulen Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und Kaiserin-Augusta-Schule sowie die Schule für Lernbehinderte betroffen.
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG)
Die Generalinstandsetzung des Gebäudes des FWG ist abgeschlossen, die Schule konnte ihr Gebäude wieder in Betrieb nehmen und ihre Interimsquartiere aufgeben.
Kaiserin-Augusta-Schule
Die Kaiserin-Augusta-Schule hat inzwischen ihren Ganztagsbetrieb aufgenommen. Dafür wurden Interimsräume auf dem Schulgelände bereitgestellt. Um den Raumbedarf der Schule langfristig zu decken, wurden die Planungen für einen Erweiterungsbau aufgenommen.
Neubau Historisches Archiv
Im Dezember 2010 hat die Stadt Köln den Architektenwettbewerb für den Neubau des Historischen Archivs am Eifelwall/Luxemburger Straße mit einem internationalen Teilnehmerwettbewerb gestartet. Dem Archiv werden künftig 20.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen, 76,3 Millionen Euro stehen als Kostenrahmen für den Komplex zur Verfügung.
Aus 200 Bewerbungen wurden insgesamt 45 Teilnehmer ermittelt, der siegreiche Entwurf des Büros Waechter & Waechter, Darmstadt, wird nach der erfolgten Konzentration auf die ausschließliche Nutzung durch das Historische Archiv mit dem Rheinischen Bildarchiv derzeit überarbeitet. Die überarbeiteten Pläne liegen vor.
Fachbeirat zum Wiederaufbau
Zur Beratung des Historischen Archivs bei allen Fragen des Wiederaufbaus hat die Stadt Köln einen 16-köpfigen Fachbeirat initiiert. Unter dem Vorsitz des Präsidenten des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Prof. Wilfried Reinighaus, gehören dem Gremium Vertreter des Bundesarchivs, des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA), der großen Archive in Köln sowie weitere Experten der Universitäten Köln und Bonn sowie der Deutschen Forschungsgesellschaft an. Sieben Projektgruppen werden begleitet: Bestandszusammenführung, Restaurierung und Konservierung, Digitalisierung und Weiterentwicklung der Software, Öffentlichkeitsarbeit, Hilfekoordination, Betreuung der Nachlassgeber und Depositare, Neubau und Provisorisches Archiv. Bislang wurden sechs Konzepte in acht Sitzungen evaluiert und verabschiedet.
Bergungsbauwerk und Besichtigungsbauwerk
Zur Bergung der unterhalb des Grundwasserspiegels befindlichen Archivalien entstand im Sommer/Herbst 2010 unmittelbar an der östlichen Schlitzwand des Gleiswechselbauwerks am Waidmarkt unter schwierigsten Randbedingungen die sog. Bergungsbaugrube, eine Baugrube innerhalb des Einsturztrichters des Archivgebäudes in der Größe von etwa 16,5 Metern mal 30 Metern. Das Bergungsbauwerk bestand aus 63 Bohrpfählen, die bis in circa 30 Metern Tiefe gebohrt werden mussten. Die Grobreinigung und Sortierung der geborgenen Archivalien erfolgte in einem beheizbaren Versorgungszelt.
Im Zusammenhang mit der Bergung der restlichen Archivalien erfolgte die Beseitigung von insgesamt circa 170 Tonnen Fundamentresten des ehemaligen Archivgebäudes, wobei die größten Einzelfundamente ein Gewicht von bis zu 40 Tonnen erreichten. Die Entsorgung dieser Trümmer- und Fundamentreste war erforderlich, um anschließend das Besichtigungsbauwerk errichten zu können. Insgesamt sind im Rahmen der Bergungsbaugrube rund 3.100 Kubikmeter Erdreich, Fundamentreste und so weiter geborgen worden. Das entspricht circa 500 Lkw-Fuhren.
Ab Herbst 2012 ist im vermuteten Schadensbereich der östlichen Schlitzwand die circa 12 Meter lange und 5 Meter breite Besichtigungsbaugrube auf Anordnung des Landgerichts Köln und im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Köln errichtet worden, um diesen Bereich vollständig ausschachten zu können und die Einsturzursache beweissicher feststellen zu können.
Zukunft des Grundstücks Severinstraße
Die künftige Nutzung des Einsturzgeländes wird unter breiter Beteiligung der Kölner Bürger diskutiert und entschieden werden. Das Planungsdezernat der Stadt Köln hat dazu eine erweiterte Bürgerbeteiligung entwickelt. Bereits im April 2011 fand dazu die erste öffentliche Informationsveranstaltung in der Piazzetta des Historischen Rathauses statt.
Zu den städtebaulichen Aspekten und Anforderungen, die an die Flächen des ehemaligen Archivs gestellt werden, gehören:
- die dringend benötigte Erweiterung der Kaiserin-Augusta-Schule am Georgsplatz
- die Schaffung eines Verbindungswegs zwischen Kaiserin-Augusta-Schule, Severinstraße und Friedrich-Wilhelm-Gymnasium.
- Auswahl des Ortes und die Gestaltung des Gedenkens
- Schließung der städtebaulichen Lücke an der Severinstraße mit der Möglichkeit, im Erdgeschoss Räume für publikumswirksame Nutzungen zu schaffen.
Rechtsverfahren und Schadenssumme
Die Stadt Köln geht von einer Gesamtschadenssumme für die Stadt Köln von mindestens 1 Milliarde Euro aus.
Zur Wahrung ihrer Rechte ist die Stadt Köln nach dem Unglück dem von der KVB unmittelbar gegen die Arbeitsgemeinschaft Nord-Süd Stadtbahn Köln Los Süd eingeleiteten selbständigen Beweisverfahren (Aktenzeichen 5 OH 1/10) vor dem Landgericht Köln als (Mit-) Antragstellerin beigetreten. Im Rahmen dieses Verfahrens erhebt das Gericht Beweis über folgende Fragen:
- Was ist die Ursache für den Einsturz?
- Hätte sich das Unglück vermeiden lassen und wenn ja, durch welche Maßnahmen?
- Liegt ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vor?
Zur Sicherung der finanziellen Ansprüche der Stadt Köln hat die Stadt Köln außerdem die Einleitung eines weiteren separaten selbständigen gerichtlichen Beweisverfahrens zur Schadenshöhe gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen (zunächst die ARGE Nord-Süd Stadtbahn Köln Los Süd mit ihren ARGE-Partnern) eingeleitet.
Da neben der Stadt Köln und der KVB auch noch zahlreiche Leihgeber durch den Einsturz geschädigt worden sind, hat die Stadt Köln allen Leihgebern des Historischen Archivs angeboten, ihre Schadensersatzansprüche an die Stadt Köln abzutreten. Die meisten Leihgeber haben hiervon Gebrauch gemacht, so dass auch deren Schadensersatzansprüche Gegenstand der beiden gerichtlichen Beweisverfahren sind und damit die Feststellungen der Gutachter auch für die Leihgeber Gültigkeit haben.
Lagerungsdichten des Bodens vor Verdachtsflächen (Fugen) der östlichen Schlitzwand [PDF, 355 KB]
Quelle: Stadt Köln – Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Inge Schürmann, Pressemitteilung, 24.2.2014